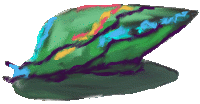
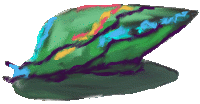
Bei der Pharmakotherapie fragt der Arzt den Patienten: Was kann ich für Sie tun?
Bei der Psychotherapie fragt der Patient den Arzt: Was kann ich für mich tun?
Psychopathologie ist der Versuch, sich und die Welt auf komplizierten Wegen zu beeinflussen. Sie ist der Versuch, sich von der Wirklichkeit zu befreien statt zu ihr. Der Gesunde stellt sich und nimmt an. Der Kranke verdrängt, betäubt, ersetzt, umgeht und vermeidet.
Psychische und psychosomatische Symptome werden durch Selbstwerturteile, Verhaltensmuster, soziale Prägungen, Selbst- und Weltbilder, Grundüberzeugungen, affektive Gewohnheiten sowie zwischenmenschliche Umgangsformen verursacht. Änderungen des Verhaltens, der Denkweisen, der Wahrnehmungs- und Kommunikationsmuster führen daher zur Beseitigung der Symptome. Das ist der gemeinsame Ausgangspunkt aller psychotherapeutischen Ansätze.
Während die Pharmakotherapie psychischer Störungen am Körper ansetzt, versteht man unter Psychotherapie jede gezielte therapeutische Maßnahme, die sich unmittelbar an die Person des Patienten richtet, um deren Umgang mit der Wirklichkeit zu verändern.
Eine Variante legt den Schwerpunkt gezielt auf das Verhalten. Sie heißt dementsprechend Verhaltenstherapie.
Bei der Verhaltenstherapie versucht der Patient Methoden zu erlernen, durch die er wirksam auf die Wirklichkeit Einfluss nehmen kann, um sie in seinem Interesse zu formen. Ihr Prinzip heißt Eingreifen.
Bei der Tiefenpsychologischen Therapie untersucht der Patient die Motive seines Handelns. Dadurch erkennt er das Bild der Wirklichkeit, aus dem heraus er ihr begegnet. Ihr Prinzip heißt Verstehen. Verstehen heißt, den Standpunkt zu verschieben. Im therapeutischen Alltag macht es Sinn, beide Ansätze miteinander zu verbinden.
Verantwortung
Psychotherapie hilft vor allem dem, der davon ausgeht, dass er selbst die maßgebliche Ursache seines Leidens ist. Folglich ist das Kernprinzip der Psychotherapie die Übernahme der Verantwortung des Patienten für sich selbst. Verantwortung besteht im Bekenntnis: Ich bin in erster Linie Opfer meines Fehlverhaltens und erst dann auch Opfer fremder Machenschaften. Wer diese Verantwortung nicht übernehmen will oder kann, wird von einer Psychotherapie nur wenig profitieren. Sie stillt vorübergehend das Bedürfnis nach Zuwendung. Mehr meist nicht.
Die Klage über andere Leute oder momentane Missstände kann Etappe zum Eigentlichen sein; aber nur, wenn die Etappe überwunden wird. Sonst ist sie die Fortsetzung eines Fehlverhaltens zu Lasten der Krankenkasse.
Psychotherapie hilft nicht bei jedem Problem. Ihre Wirksamkeit setzt voraus, dass die Ursache des Problems in der Person des Patienten liegt und dass er sich aktiv an der Lösung beteiligen will... und kann. Mehr noch: Die Aktivität des Patienten ist Grundbedingung für den Erfolg der Therapie. Nur bei der klassischen Hypnose gilt das nicht. Dabei bleibt der Patient passives Ziel heilender Suggestionen.
Vor Beginn einer Psychotherapie ist zu klären:
Folgende Tabelle gibt einen Überblick über das Gewicht der vier Grundmuster bei den häufigsten therapeutischen Schulen.
Therapeutische Prinzipien
| Therapieschule | aufdeckend | übend | suggestiv | bestärkend |
| Psychoanalyse | +++ | - | - | - |
| Tiefenpsychologie | +++ | - | - | + |
| Gestalttherapie | +++ | - | - | + |
| Transaktionsanalyse | ++ | + | - | + |
| Psychodrama | +++ | + | - | + |
| Systemische Therapie | ++ | ++ | - | + |
| Kognitive Verhaltenstherapie | ++ | ++ | - | + |
| Klassische Verhaltenstherapie | - | +++ | - | + |
| Gesprächstherapie | + | - | + | +++ |
| Klassische Hypnose | - | - | +++ | + |
| Autogenes Training | - | +++ | ++ | ++ |
| Positives Denken | - | + | +++ | ++ |
Das Autogene Training ist autosuggestiv. Man suggeriert sich: Mein Arm ist schwer. Meine Stirn ist kühl etc. Unterlässt man die Autosuggestion und fühlt stattdessen in Arm und Stirn hinein, um festzustellen, was man dort ohne suggestive Formel tatsächlich fühlt, wird die Technik meditativ.
Meditation ist keiner Therapieschule zuzuordnen. Sie gilt auch nicht als psychotherapeutische Methode. Trotzdem ist sie ein Verfahren mit großer therapeutischer Wirksamkeit. In der Tabelle wäre sie so einzuordnen...
| Verfahren | aufdeckend | übend | suggestiv | bestärkend |
| Meditation | +++ | +++ | - | +++ |
Meditation...
Wohlgemerkt: Es gibt auch autosuggestive Meditationsformen, zum Beispiel die Visualisierung Tschenresis, des Bodhisattvas des universellen Mitgefühls im tibetischen Mahayana-Buddhismus. Beim autosuggestiven Ansatz der Meditation versucht sich der Praktizierende einem Vorstellungsbild anzupassen. Er will bestimmte Eigenschaften entwickeln. Autosuggestion wirkt aufdeckender Erkenntnis entgegen.
Tatsächlich sind die Schwerpunkte nicht nur den Therapieformen zuzuordnen, sondern ihr Einsatz hängt von der Persönlichkeit des Therapeuten ab. Die Mehrheit der Therapeuten beschränkt sich heute nicht mehr prinzipiell auf eine therapeutische Methode, sondern mischt Methoden zugeschnitten auf die Persönlichkeit des Patienten und das Problem, das es zu lösen gilt. Ein Beispiel für den Methodenmix ist die Kognitive Verhaltenstherapie, die den aufdeckenden Ansatz der tiefenpsychologisch-analytischen Therapien mit dem übenden Ansatz der Klassischen Verhaltenstherapie kombiniert. Da sich Selbsterkenntnis und praktische Anwendung neuer Verhaltensmuster wechselseitig befruchten, ist die kognitive Verhaltenstherapie zur Behandlung vieler Probleme geeignet.
Man kann etwas verändern, indem man Veränderung will. Man verändert aber auch, indem man anerkennt, was man ist. Zuzulassen, dass die eigene Entwicklung ungestört vonstattengeht, ist eine hohe Kunst. Etwas zu lassen ist oft schwerer als etwas zu tun.
Unverstandene Motive haben großen Einfluss auf das Erleben. Vieles was wir tun, tun wir nicht, weil wir uns bewusst dazu entschieden hätten, sondern weil wir verborgenen Impulsen folgen. Diese Impulse entspringen drei seelischen Bedürfnissen, die ineinander verschränkt sind und zeitlebens miteinander um eine Kompromisslösung ringen:
Das erste Bedürfnis ist Grundlage des Selbstwertgefühls, die beiden anderen bilden die Pole des Psychologischen Grundkonflikts.
Je nach biographischer Prägung und persönlichem Temperament entwickeln Menschen unterschiedliche Strategien, um mit der Rivalität beider Bedürfnisse angesichts realer Umfeldbedingungen umzugehen. Diese Strategien nennt man Abwehrmechanismen.
Abwehrmechanismen sind Problemlösungsversuche. Oft lösen sie die zugrundeliegenden seelischen Konflikte jedoch nur unvollständig und haben dabei unerwünschte Nebenwirkungen: Sie produzieren psychische Symptome. Grundprinzip aller aufdeckenden Therapien ist es, sowohl die Kräfte der verborgenen Bedürfnisse als auch untaugliche Abwehrmanöver bewusst zu machen; denn wenn der Patient sein seelisches Innenleben besser kennt, kann er es angemessener mit den realen Gegebenheiten abgleichen. Und je besser der Abgleich gelingt, desto weniger Symptome hat er.
Zwei Blickrichtungen
Was zählt, ist das, was in mir selbst geschieht. Wie reagiere ich auf die Welt?
Individualpsychologische Dynamiken bewusst zu machen, ist eine wesentliche Komponente bei der Psychotherapie komplexer psychologischer Probleme; vor allem, wenn ausgeprägte Störungen der Regulation des Selbstwertgefühls und heftige zwischenmenschliche Spannungen bestehen. Darunter leiden vor allem Patienten mit Persönlichkeitsstörungen sowie solche mit komplexen Angsterkrankungen, Zwangs- und Essstörungen sowie chronischen Depressionen.
Zur Aufdeckung unbewusster Konflikte ermutigt die klassische Psychoanalyse den Patienten, ungestört seinen Gedanken zu folgen. Der Fachbegriff dazu heißt freie Assoziation. Frei meint zweierlei: unabgelenkt und unzensiert.
Um die gedanklichen Verknüpfungen nicht durch äußere Einflüsse abzulenken, verhält sich der Analytiker abstinent. Das heißt: Er hält sich mit Kommentaren, Bewertungen und Deutungen dessen, was der Patient berichtet, fast vollständig zurück. Damit der Patient keine Bewertungen aus der Mimik des Therapeuten herauslesen kann oder zu können glaubt, sitzt dieser am Kopfende der Couch, sodass der Patient sein Gesicht nicht sieht.
Der Patient wird dazu angehalten, Einfälle auch dann zu äußern, wenn sie ihm peinlich sind. Zur freien Assoziation gehört, dass der Patient seine Ideen nicht zensiert. Gerade dadurch werden verborgene, also bislang unbewusste Motive und Wirkkräfte aufdeckt, die sein leidvolles Erleben bedingen. Indem der Patient innerseelische Ursachen erkennt, wird er im eigentlichen Sinne des Wortes selbstbewusster. Statt von Automatismen ins Leid gesteuert zu werden, erkennt er, was ihn steuert.
Die Tiefenpsychologische Psychotherapie greift auf viele Denkmodelle der Psychoanalyse zurück. Auch ihr zentrales Ziel heißt, bislang Unbewusstes bewusst zu machen. Dazu bietet der Therapeut einen aktiven Dialog über Ängste, Zweifel und Widersprüche im Erleben des Patienten an. Das Abstinenzgebot der Tiefenpsychologie ist weniger strikt als das der Psychoanalyse. Trotzdem hat auch hier der Therapeut darauf zu achten, dass er Deutungen nur anbietet, statt sie dem Patienten aufzudrängen. Sobald er etwas aufdrängt, handelt er selbst aus unbewussten Motiven.
Die systemischen Therapien, wie die Interpersonelle Psychotherapie und die Familientherapie, konzentrieren sich besonders auf den Umgang des Patienten mit seinen Bezugspersonen. Sie decken Beziehungsmuster und damit korrelierende persönliche Einstellungen auf.
Die Varianten der humanistischen Psychotherapie, wie die Gestalttherapie und das Psychodrama, setzen zur Bewusstmachung auf experimentelle Rollenspiele. Dabei geht es jedoch nicht darum, eine Rolle gut zu spielen, sondern dem Rollenspieler bewusst zu machen, was in ihm vor sich geht.
Da ihm die Rolle, die er in der Welt spielt, als etwas überwertig Wichtiges vor Augen steht, hängt sein Befinden vom Wellengang vorübergehender Ereignisse ab, auf die er selbst nur wenig Einfluss hat. So gesehen ist neurotisches Leid Folge einer Fehlinterpretation der Wirklichkeit. Der Neurotiker ist neurotisch...
Therapiemethoden, deren wesentlicher Ansatz im Aufdecken unbewusster seelischer Motive liegt, werden als tiefenpsychologische Ansätze bezeichnet. Dazu gehören auch die psychoanalytischen Schulen, die sich auf Freud, Adler, Jung oder deren Schüler berufen.
Ziele und Methoden der Tiefenpsychologie
| Ziel | Methode | Frage |
| Gesteigerte Wahrnehmung der aktuellen innerseelischen Dynamik | Hinführung zur Introspektion (Innenschau) | Was geht jetzt in mir vor? |
| Aufarbeitung unverarbeiteter Traumata | Erinnerung an traumatische Erlebnisse Abschluss unterbrochener emotionaler Abläufe |
Was will ich bis heute nicht wahrhaben? |
| Einblick in individuelle psychodynamische Grundmuster | Analyse der Abwehrmechanismen |
Wie steuere ich mich selbst? Welche Methoden verwende ich, um mein Selbstwertgefühl zu stabilisieren? Welche schädlichen Nebenwirkungen haben diese Methoden? |
| Stärkung des Selbst gegenüber dem Selbstbild | Unterscheidung zwischen Selbst und Selbstbild |
Wie bin ich tatsächlich? Was will ich sein? |
| Verständnis kausaler Zusammenhänge | Untersuchung der seelischen Entwicklung im Laufe der Zeit |
Wie bin ich geworden, was ich heute bin? |
Grundprinzip
Erkenne dich selbst. Dann ändert sich dein Verhalten.
Übende Verfahren gehen davon aus, dass psychische Symptome Resultat dysfunktionaler Verhaltensweisen sind, die der Patient im Laufe des Lebens erlernt hat. Damit der Patient umlernt, entwirft der Therapeut ein Übungsprogramm, das solange eingehalten wird, bis das symptomerzeugende Verhalten durch ein funktionales ersetzt ist.
Übende Verfahren vom Typ der Verhaltenstherapie sind vor allem bei umschriebenen, gut abgrenzbaren Problemen nützlich. Eines ihrer Haupteinsatzgebiete liegt bei den isolierten Phobien.
Häufige Phobien
Grundsätzlich können aber auch bei der Behandlung Depressionen und Suchterkrankungen Übungs- und Verhaltensprogramme entworfen werden, die maßgeblich zur Symptombehebung beitragen.
Übende Verfahren setzen eine besonders aktive Beteiligung des Patienten voraus. Er hat konkrete Hausaufgaben zu bewältigen und über den zeitlichen Verlauf der Symptomstärke Buch zu führen. Bei Expositionsbehandlungen, wenn er zum Beispiel wegen Höhenangst mit dem Therapeuten einen Turm besteigt, muss er unter Umständen erhebliche Ängste ertragen. Eine dieser Techniken wird als Flooding, also Flutung, bezeichnet. Dabei ist die Konfrontation mit der Angst besonders radikal.
Den übenden Verfahren ist auch das Autogene Training zuzurechnen, bei dem durch ein abgestuftes Verhaltensprogramm Entspannung, Entängstigung oder Linderung psychogener Schmerzen angestrebt wird. Der Patient übt das Erleben einer gelassenen Selbstwahrnehmung ein.
Die ursprüngliche Verhaltenstherapie formulierte eine radikale Gegenposition zur älteren Psychoanalyse. Sie schloss reflektierende Selbsterkenntnis als therapeutisches Element aus und konzentrierte sich auf das Training funktionaler Verhaltensmuster. Erst als sie das tiefenpsychologische Grundprinzip der heilenden Selbsterkenntnis wiederentdeckte, wurde sie als Kognitive Verhaltenstherapie zu dem therapeutischen Ansatz, der heute angewendet wird.
Ziele und Methoden der Verhaltenstherapie
| Ziel | Prinzip | Methoden |
| Identifikation und Beschreibung der Probleme | Problemanalyse |
Identifikation von Problembereichen Entwicklung von Lösungsstrategien |
| Verbesserung der Fähigkeit, Probleme durch gezielte Verhaltensänderungen selbständig zu lösen | Training von Problemlösefähigkeiten | Umsetzen alternativen Verhaltens im Alltag oder im Rollenspiel Verhaltens- und Verstärkerpläne unter Anwendung von Selbstbeobachtung und Selbstbelohnung |
| Selbstsicheres Verhalten | Training sozialer Kompetenzen | Gezieltes Einüben selbstsicheren Verhaltens Rollenspiele |
| Ersatz dysfunktionaler durch funktionale Gedanken | Kognitive Umstrukturierung |
Hinterfragen negativer Bewertungen, protokollierte Selbstbeobachtung, Überprüfung der Richtigkeit gedanklicher Vorstellungen |
| Aktivitätsaufbau | Gezielte Verhaltenssteuerung |
Systematische Planung und Durchführung fruchtbarer Aktivitäten |
| Abbau von Angst und Spannung | Entspannungstraining |
Einüben von Autogenem Training oder anderen Entspannungsverfahren |
Grundprinzip
Ändere dein Verhalten. Dann geht es dir besser.
Bei hypnotherapeutischen Ansätzen versucht der Therapeut seelische Muster durch Suggestion zu verändern. Die klassische Hypnose umgeht dabei die individuelle Selbstregulation des Patienten. Insofern ist sie eine Sonderform: Bei ihr gilt der Grundsatz vom aktiven Patienten nicht.
Bei anderen hypnotherapeutischen Ansätzen steht weniger die suggestive Verankerung stärkender Selbstbilder im Vordergrund und mehr die Hoffnung, durch Trancezustände verdrängte Bewusstseinsinhalte besser zu erreichen; entweder um sie so bewusst zu machen oder um ihre kreative Dynamik anzuregen.
Auch das Autogene Training und das sogenannte Positive Denken nutzen suggestive Mechanismen. Hier ist die Aktivität des Patienten wiederum gefragt: Indem er nämlich Entspannungsübungen eintrainiert oder sich sprachlicher Formeln bedient, durch die er sein Selbstwertgefühl und sein Selbstvertrauen autosuggestiv bestärkt.
Beispiele autosuggestiver Formeln
In jüngerer Zeit hat sich eine spezielle Methode besonders im Rahmen der Therapie Posttraumatischer Störungen etabliert: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
Die Wirkweise der Methode wird kontrovers diskutiert. Zu vermuten ist, dass suggestive Effekte eine wichtige Rolle spielen. Das Setting des EMDR ist dem der Hypnotherapie nachgebildet. Wie bei der klassischen Hypnose wird der Patient aufgefordert, den Finger des Therapeuten zu fixieren. Dabei wird der Finger hin- und her bewegt. Zur Vorbereitung wählt der Patient ein Vorstellungsbild als einen sogenannt sicheren Ort, wohin er bei emotionaler Überforderung im Geiste flüchten kann; zum Beispiel das Bild einer Sommerwiese.
Dann wird eine positive Selbstüberzeugung verankert (z.B.: Ich kann etwas tun, um mich zu schützen.), die die negative Selbstüberzeugung, die durch das Trauma ausgelöst wurde (z.B.: Ich bin der Vernichtung hilflos preisgegeben und lebe ständig in Gefahr.) überschreibt. Auch das Vorstellungsbild des sicheren Orts ist suggestiv. Es flößt dem Patienten ein Gefühl der Sicherheit ein.
Bei der Gesprächstherapie nach Rogers ist Bestärkung und Bestätigung das tragende Element der Therapie. Aber auch in anderen Therapieformen spielt sie eine wesentliche Rolle. Gerade ängstliche und selbstunsichere Patienten brauchen direkten Zuspruch und Ermutigung. Viele Menschen stehen extrem unter Druck und haben im Alltag keine Möglichkeit, überhaupt ein vertrauliches Gespräch zu führen, sodass es dem Therapeuten zunächst lediglich zukommt, aufmerksam zuzuhören. Dabei ist er bewusst parteiisch und hebt beharrlich den positiven Anteil des zwiespältigen Erlebens des Patienten hervor.
Akzeptanz, also die Bestätigung, dass ein Erleben, so wie es ist, in Ordnung und verstehbar ist, ist eine Grundlage zur Heilung schwerer Persönlichkeitsproblematiken. Im Konzept der sogenannten radikalen Akzeptanz wird die Methode konsequent zu Ende gedacht. Die bewertende Unterscheidung zwischen positiven bzw. negativen Aspekten des Erlebens wird aufgegeben. Radikal heißt: Jedwedes Erleben wird kritikfrei akzeptiert, ohne der Versuchung nachzugeben, es zu bewerten oder zu verbessern.
Begriffsverwirrung
Der Begriff positiv wird meist bewertend verwendet. Im Gegensatz zum Negativen, das als minderwertig abzulehnen sei, gilt das Positive als berechtigt, angenommen und bestätigt zu werden. Das ist kurz gedacht. Positiv entstammt dem lateinischen positivus = gegeben, gesetzt. Das im Hier-und-Jetzt faktisch Gegebene ist somit bereits positiv. Es ist an die Position gesetzt, an der es erscheint. Seine Existenzberechtigung ist nicht abzulehnen, sondern seine schiere Existenz ist anzuerkennen.
Die Spaltung der Wirklichkeit in vermeintlich positive und negative Aspekte ist Resultat egozentrischen Denkens. Es setzt Vorstellungen gleich, die zu unterscheiden sind. Was das Ego als positiv anerkennt, ist bloß das, wovon es glaubt, dass es ihm nützt; meist sogar nur das, was momentan angenehm ist. Tatsächlich kann aber nur die Wirklichkeit als Ganzes Basis eines Lebens sein, das sich darin entfaltet.
Was ist das übliche Muster psychisch schwerkranker Menschen?
Folge dieser Grundirrtümer ist die fortgesetzte, selbstquälerische negative Bewertung eigener Taten, Gefühle und Eigenschaften, oder aber kompensatorische Größenphantasien. Solche Bewertungen gehen nahtlos in problematische Beziehungsmuster über. Wer nicht mit sich im Reinen ist, ist in der Beziehung zu anderen unauthentisch, befangen, gehemmt, manipulativ, übergriffig oder fordernd. Er glaubt, von der Bestätigung anderer abzuhängen, weil er sein eigenes Sosein selbst nicht bestätigt.
Impuls und Umsetzung
Akzeptanz ist ein innerseelischer Prozess. Er führt zur Veränderung der Einstellung zu sich selbst und der Welt. Ich nehme meine Erfahrung, mein Sosein und mein Erleben an, wie sie sind. Akzeptanz beinhaltet nicht, dass man jeden Impuls in entsprechende Taten umsetzt. Ich akzeptiere mich heißt nicht, ich tue das, wozu es mich gerade mal am meisten drängt. Oft heißt es nur: Ich anerkenne, dass mich etwas drängt.
Radikale Akzeptanz wirkt den pathogenen Überzeugungen entgegen. Allerdings wirkt sie nicht als bloß intellektueller Beschluss. Akzeptanz muss in kleinen Schritten im tatsächlichen Erleben des jeweiligen Hier-und-Jetzt eingeübt und faktisch vollzogen werden. Da man nur akzeptieren kann, was man erkennt, bedarf das Konzept der radikalen Akzeptanz aufdeckender Selbsterkenntnis. Wer lernen will, sich selbst zu akzeptieren, muss erkennen, wie er jetzt tatsächlich ist:
Erst wenn er erkennt hat, welche Erscheinungsform seiner selbst jetzt verwirklicht ist, kann er sagen: So bin ich jetzt und jetzt ist das in Ordnung so. Wer Erscheinungsformen seiner selbst erkennt, erkennt oft im gleichen Zuge, dass er sie nicht akzeptieren will oder kann. Dann gilt es zunächst zu akzeptieren, dass man die betreffende Erscheinungsform nicht akzeptieren kann. Auch das Unvermögen, eine Erscheinungsform zu akzeptieren, ist eine Erscheinungsform, die so, wie sie ist, gegeben und damit in der Ordnung der Wirklichkeit ist.
Auch die Psychoedukation kann im weitesten Sinne als psycho- bzw. verhaltenstherapeutisches Element aufgefasst werden. Sie spielt besonders bei solchen Erkrankungen eine Rolle, die auf körperliche Faktoren zurückzuführen und somit durch Psychotherapie im engeren Sinne nicht heilbar sind. Zu nennen sind Psychosen und affektive Störungen, die auf Stoffwechselstörungen beruhen. Aber auch bei Suchterkrankungen oder bestimmten Störungen der Sexualpräferenz hat sie eine große Bedeutung.
Unterschiede
Psychotherapie beeinflusst das Selbstbild und die Struktur psychischer Programme.
Unter Psychoedukation versteht man die Aufklärung des Patienten über Art, Ursprung, Verlauf und Bewältigungsmöglichkeiten seiner Erkrankung. Der Kern besteht dabei in der Aufklärung darüber, was der Patient durch eigenes Tun zur Milderung des Krankheitsverlaufs beitragen kann.
Themen der Psychoedukation
Psychotherapie ist eine individuelle Vorgehensweise. Gewiss: Auch bei der Pharmakotherapie psychischer Störungen sind individuelle Eigenschaften des Patienten zu beachten. Das Spektrum der Wirkmittel, das zum Einsatz kommt, ist aber überschaubar. Es besteht aus den Substanzen, die zur Behandlung des Krankheitsbildes jeweils verfügbar sind. Dasselbe Antidepressivum kann bei tausend Patienten zur Anwendung kommen.
Bei der Psychotherapie ist das anders. Es können zwar Grundzüge beschrieben werden, trotzdem ist jeder psychotherapeutische Prozess einzigartig. Er entwickelt sich zwischen diesem speziellen Patienten und seinem jeweils individuellen Therapeuten. Deshalb ist es nicht möglich, Psychotherapie so eindeutig und operational als Verfahrensablauf zu beschreiben, wie man es zum Beispiel für die Vorgehensweise bei der pharmakologischen Behandlung von Depressionen machen kann.
Während Psychopharmaka darüber hinaus gegen umschriebene Krankheitsbilder einsetzt werden, wendet sich die Psychotherapie im Gegensatz dazu an den einzelnen Menschen selbst. Behandelt wird nicht die Krankheit oder deren biochemische Grundlage. Behandelt wird das Individuum als Ganzes.
Trotzdem ist Psychotherapie etwas anderes als ein beliebiges Gespräch, das sich zwischen zwei Individuen entwickeln mag und ebenfalls Einzigartigkeit für sich in Anspruch nehmen kann. Es ist möglich, wesentliche Grundzüge zu benennen, die ein bloßes Gespräch von einer therapeutischen Intervention unterscheiden.
Wohlgemerkt
Psychotherapie ist nichts Einheitliches. Potenziell psychotherapeutisch wirksam ist ein breit gefächertes Spektrum kommunikativer Methoden, bei denen jede erheblich von anderen abweichen kann. Wenn hier von Grundzügen die Rede ist, die als gemeinsame Leitlinien der Psychotherapie formuliert werden, dann ist das nur ein Entwurf, der allerdings die Erfahrung vieler Therapeuten widerspiegelt.
Zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Psychotherapie gehört zweierlei:
Zum Leben des zufriedenen Menschen gehören drei Fähigkeiten:
Zwei Formen der Selbstbestimmung
Gemeinsamer Nenner aller unglücklichen Menschen ist es, über mindestens eine dieser Fähigkeiten nur ungenügend zu verfügen. Die ersten beiden Fähigkeiten entsprechen den polaren Bedürfnissen des Psychologischen Grundkonflikts: Zugehörigkeit und Selbstbestimmung. Die dritte Fähigkeit ist untrennbar mit den beiden ersten verzahnt. Es ist die Fähigkeit, auch dann ein stabiles Selbstwertgefühl aufrecht zu erhalten, wenn die Umstände widrig sind.
Die Verzahnung zwischen Zugehörigkeit und Selbstbestimmung einerseits und dem Selbstwertgefühl andererseits ist keine Einbahnstraße. Gelungene Zugehörigkeit und erfolgreiche Selbstbestimmung stabilisieren das Selbstwertgefühl. Ein stabiles Selbstwertgefühl ermutigt dazu, über sich selbst zu bestimmen und sich geeigneten Gemeinschaften vertrauensvoll anzuschließen.
Die These, dass sich der Therapeut dem Patienten gegenüber so verhalten sollte, dass der Patient die Therapie als hilfreich erleben und annehmen kann, ist ein Gemeinplatz. So selbstverständlich wie sie klingen mag, ist ihre Umsetzung im therapeutischen Alltag aber nicht. Therapeuten stehen zwei Herausforderungen gegenüber, die sie nur schwer zu 100% meistern.
Die Grundhaltungen, um die es hier geht, sind die der Wertschätzung und der Abstinenz. Sie ergänzen sich wechselseitig. Wer einen Menschen wertschätzt, wird ein Gespräch, bei dem es um diesen Menschen geht, nicht dazu nutzen, um eigene Bedürfnisse zu erfüllen. Nur wer in der Lage ist, die eigenen Bedürfnisse bei Bedarf zurückzustellen, ist in der Lage, einen anderen vollgültig wertzuschätzen.
Jeder Therapeut ist gut beraten, niemals davon auszugehen, dass er beide Aufgaben - wertzuschätzen und seine eigenen Bedürfnisse aus der Therapie herauszuhalten - bereits ein für alle Mal gelöst hat. Es macht Sinn, hier stets achtsam zu sein. Jeder neue Fortschritt, den der Therapeut bei der Lösung dieser Aufgaben macht, kommt nicht nur seinen Patienten, sondern auch ihm selbst zu Gute.
Kaum ein Therapeut wird bezweifeln, dass die Wertschätzung des Patienten erstrangige Grundlage einer erfolgversprechenden Psychotherapie ist. So klar die Vorgabe im Raume steht, so häufig bleibt ihre Erfüllung aber auch hinter dem Optimum zurück. Das braucht uns nicht zu verwundern. Wären alle Menschen unbefangen charmante, anregende und aufmerksame Gesprächspartner mit Feingefühl, ausgefeilter Introspektionsfähigkeit und guter Sitte, wären die meisten Psychotherapeuten arbeitslos. Menschen, deren Kommunikationsfähigkeit nichts zu wünschen übriglässt, sind meist in der Lage, so viele fruchtbare Beziehungen herzustellen, sodass sie eine Psychotherapie gar nicht erst brauchen.
So kommt es, dass der Therapeut auf Menschen trifft, deren Ungeschick im Umgang mit anderen mit dafür sorgt, dass sie nur wenig Wertschätzung erfahren. Das gleiche Ungeschick legen sie beim Betreten der Praxis nicht ab. Manche Patienten...
Der Aufbau einer fruchtbaren Kommunikation mit solchen Patienten ist erschwert. Die Arbeit mit ihnen erscheint dem Therapeuten oft mühsam und wenig effizient. Er kann versucht sein, die Frustration, sich selbst nicht als effizienten Helfer zu erleben, durch Phantasien über eine vermeintliche Minderwertigkeit des Patienten abzuwehren oder gar solche Phantasien durch Ungeduld oder Herablassung auszuagieren.
Schwierige Menschen auch dann bedingungslos wertzuschätzen, wenn sie mit Eigenschaften behaftet sind, die er als unangenehm empfindet, ist eine Aufgabe, an deren Lösung sich jeder Therapeut schulen sollte. Ihre Lösung bedarf großer Aufmerksamkeit beim Erspüren eigener Widerstände und eine gelassene Selbstbejahung, die ohne Abwertungen auskommt.
Wertschätzung bezieht sich in der Therapie aber nicht nur auf den Patienten selbst. Sie bezieht sich auch auf die Bezugspersonen, von denen der Patient berichtet; und zwar ausdrücklich auch dann, wenn der Patient sie als Übeltäter beschreibt und sie seinerseits abwertet. In die Empörung des Patienten über tatsächliches oder angebliches Fehlverhalten Dritter einzustimmen, mag ein Bündnis mit ihm begründen, lösungsorientiert ist es selten. Vor allem, wenn der Patient persönliche Bezugspersonen abwertet, hilft es ihm langfristig mehr, wenn sich der Therapeut nicht daran beteiligt, Türen durch entwertende Affekte zuzuschlagen, sondern davon ausgeht, dass auch der übelste Widersacher des Patienten sein eigenes Schicksal hat, vor dessen Hintergrund seine Taten zumindest psychodynamisch verstehbar sind.
Zu den gröbsten Verstößen gegen die therapeutische Grundhaltung der Abstinenz gehört der sexuelle Übergriff. Therapeuten, die sexuelle Beziehungen zu Patienten eingehen, befriedigen dadurch zweifellos eigene psychologische Bedürfnisse. Wie groß der Schaden ist, der dadurch entsteht, kann nur von Fall zu Fall erwogen werden. Die Gefahr, dass schwerer Schaden entsteht, ist jedoch groß; vor allem, wenn die Initiative vom Therapeuten ausgeht und sein in der Regel weibliches Opfer unter einer schweren Selbstwertproblematik leidet. Sich als Objekt fremder Begierden zu erleben, kann das Problem dramatisch vertiefen.
Zwei Formen der Abstinenz
Das ursprüngliche Abstinenzgebot der Psychoanalyse betraf Informationen über die Person des Therapeuten. Der sollte sich vollständig bedeckt halten, damit der Patient nicht vom eigenen Prozess abgelenkt wird. Zweifellos ist es falsch, wenn die Person des Therapeuten im therapeutischen Gespräch in den Vordergrund rückt. Trotzdem kann es gelegentlich hilfreich sein, auf eigene Erfahrungen zu verweisen; wenn ein älterer Therapeut zum Beispiel gegenüber einem jungen Patienten, der sich in alterstypische Probleme verstrickt hat, durchblicken lässt, dass auch er einst mit ähnlichen Problemen konfrontiert war und sie schließlich überwunden hat. Oder, wenn er über eigene Strategien im Umgang mit Schlafstörungen spricht. Derartige Abweichungen von der Abstinenzregel können Vertrauen und Zuversicht schaffen.
Problematischer sind Verstöße gegen die Abstinenz (lateinisch abstinere = sich enthalten, sich fernhalten), wenn persönliche Bedürfnisse des Therapeuten verdeckt Einfluss auf dessen Umgang mit dem Patienten nehmen. Während die Preisgabe einer Information über die Person des Therapeuten offen erkennbar ist, schleicht sich die Einflussnahme seiner Bedürfnisse in der Regel ungesehen ein.
Die Bedürfnisse, um die es dabei geht, sind die gleichen wie die, deren mangelnde Erfüllung das Leben des Patienten überschattet. Es sind die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Selbstbestimmung und einem stabilen Selbstwertempfinden. Wie jeder andere Mensch will der Therapeut dazugehören, über sich selbst bestimmen und sich als wertvoll erleben. Allein: Die Therapie ist nicht der Platz, an dem es um seine Bedürfnisse geht.
Varianten, wie sich persönliche Bedürfnisse des Therapeuten Raum verschaffen, gibt es gewiss viele. Beispielhaft seien drei genannt:
In Therapien äußern Patienten alle möglichen Meinungen über die Wirklichkeit im Allgemeinen oder soziale und gesellschaftliche Strukturen im Besonderen. Hier kann der Therapeut versucht sein, die Meinung des Patienten entgegen seinen eigentlichen Sichtweisen zu bestätigen oder den Patienten von der eigenen Sichtweise zu überzeugen; um einen Konsens herzustellen, den der Therapeut aus eigener Harmoniebedürftigkeit heraus zu brauchen glaubt.
Patienten kommen zu Therapeuten, um sie für ihre Zwecke zu verwenden. Oft kommt es vor, dass sie dem Therapeuten eine Rolle zuweisen, die gegen dessen Selbstbestimmungsimpulse verstößt. Nehmen wir an, der Patient will viel Raum, um sich über andere zu beklagen, der Therapeut hält das aber für unfruchtbar und fühlt sich als Klagemauer missbraucht. Sein Bedürfnis nach Selbstbestimmung verweigert dann womöglich die zugewiesene Rolle. Er will keine Klagemauer sein, sondern ein Experte, der dem Patienten Lösungsstrategien aufzeigt. Statt dass der Therapeut den Patienten annimmt, wie er wirklich ist, verstrickt er sich in ein Ringen um den Tenor des Gesprächs.
Wohlgemerkt
Es gibt keinen Patienten, der dem Therapeuten grundsätzlich unterlegen wäre. Jeder Patient hat die Mittel dazu, jeden Therapeuten vollständig scheitern zu lassen.
Abwertung ist einer der am häufigsten verwendeten Abwehrmechanismen. Er ist eine wesentliche Grundlage seelischen Leids. Kein Wunder, dass er von vielen Patienten praktiziert wird. Das Selbstwertgefühl des Therapeuten kann dadurch auf verschiedenste Weise auf die Probe gestellt werden:
Je mehr das Selbstwertgefühl des Therapeuten von sozialer Bestätigung abhängt, desto größer ist die Gefahr, dass er sich gegenüber Patienten, die abwertende Botschaften senden, unprofessionell verhält. Entweder versucht er...
Selbstverständlich ist der Therapeut befugt, eine Therapie zu beenden. Das sollte aber nicht geschehen, weil er sich abgewertet fühlt, sondern weil es inhaltlich Sinn macht:
Moralische Positionen
Nur wenige werden der Meinung sein, dass es auf der Welt nach menschlichem Ermessen gerecht zugeht. Das gilt für Patienten wie Therapeuten gleichermaßen. Klagen über Ungerechtigkeiten, die sie tatsächlich oder vermeintlich erlitten haben, tragen Patienten häufig vor. Was das betrifft, ist der Therapeut in einer schwierigen Lage. Einerseits macht es Sinn, dem Patienten zu signalisieren, dass der Therapeut grundsätzlich auf seiner Seite steht. Neigen Therapeuten jedoch dazu, die Welt vor allem aus dem Blickwinkel moralischer Positionen heraus zu betrachten, besteht beim Thema Gerechtigkeit die Gefahr, den Patienten einseitig als Opfer anzusehen... und sich selbst als dessen Retter.
Auch durch die Übernahme der Rolle eines Retters, der die Sichtweise des Opfers, nämlich ein Opfer böser Täter zu sein, bedingungslos teilt, wird das Abstinenzgebot subtil untergraben. Bei den persönlichen Bedürfnissen, die sich der Therapeut durch die Retterrolle erfüllen kann, handelt es sich um die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und einem gehobenen Selbstwertgefühl.
Sich dezidiert auf die Seite des Opfers zu schlagen, schafft eine Nähe, die beiderseits das Zugehörigkeitsgefühl erhöht. Opfer gegen böse Täter zu verteidigen, definiert eine Rollenposition, der ein moralisch überlegener Wert zugeordnet ist. Der Gute riskiert, sich als Guter zu gebärden, weil es ihm guttut.
Psychotherapeutisch wirksam ist ein breites Feld von Kommunikationsangeboten, die jeweils verschiedene Themen in den Vordergrund stellen. Das können belastende Erfahrungen aus der Vergangenheit, insbesondere aus der frühen Kindheit sein, Konflikte in den Beziehungen, in die der Patient aktuell verwoben ist, Träume, allfällige Gefühle, die Art, wie sich der Patient dem Therapeuten gegenüber verhält oder Muster, die er anwendet, um den Alltag zu organisieren. Gemeinsamer Nenner aller Ansätze ist es, den Patienten zu befähigen, ein Leben zu führen, das er bejaht, als sinnvoll empfindet und in dessen Vollzug er seine Kräfte unbefangen einbringt.
Die speziellen Krankheitsbilder, die die Psychiatrie beschreibt, entsprechen speziellen Umgangsformen des Patienten mit der Wirklichkeit. In den Umgangsformen tauchen als Dreh- und Angelpunkte die oben beschriebenen Themenfelder des menschlichen Erlebens auf. Der Patient erleidet ein bestimmtes Krankheitsbild, weil er die Grundbedürfnisse des Lebens durch Verhaltensweisen zu erfüllen versucht, durch die keine nachhaltige Befriedigung eintritt. Mehr noch: Die Verhaltensweisen, die er wählt, tragen dazu bei, seine Unzufriedenheit mit dem Leben zu vertiefen. Zu den wichtigsten Aufgaben jeder Psychotherapie gehört es daher, dem Patienten aufzuzeigen, wie er sein Leiden durch das eigenen Verhalten erzeugt. Die Einsicht in genau diesen Zusammenhang ist der Ausgangspunkt der heilsamen Veränderung.
Angst ist eine Erfahrung, die das menschliche Erleben stets mitbestimmt. Bei den Angsterkrankungen tritt sie als Leitsymptom unverdeckt zutage. Bei allen übrigen psychogenen Erkrankungen wird sie durch deren Leitsymptome überlagert und bleibt im Hintergrund der Leitsymptome als deren primäre Ursache bestehen.
Angst signalisiert die Gefahr, entwertet zu werden. Dem entsprechend kann sie sich auf alles beziehen, was der Mensch als entwertend empfindet. Zu allererst ist der Tod zu nennen. Er ist die vollständige Entwertung des Körpers. Als nächstes fürchtet sich der Mensch vor allem, was seinen Körper beschädigen könnte, dann vor dem, was den Wert seiner Person in der Gemeinschaft herabsetzt, schließlich vor dem Verlust all jener Personen und Gegenstände, die er als aufwertende Bestandteile seines Daseins betrachtet.
Warum, so lautet die nächste Frage, bezieht sich jede Angst des Menschen darauf, entwertet zu werden? Es ist so, weil sein Wert eng mit dem Anrecht verbunden ist, die Grundbedürfnisse des Daseins zu erfüllen: Zugehörigkeit und Selbstbestimmung.
Wer nicht als wertvoll betrachtet wird, wird in keine Gemeinschaft aufgenommen. Wer als weniger wertvoll betrachtet wird, wird nur am Rand der Gesellschaft geduldet.
Daraus folgt logisch: Das gemeinsame Motiv, das den psychologischen Grundbedürfnissen entspringt, ist der Wunsch vor sich selbst und anderen als wertvoll zu gelten. Die übergeordnete Furcht heißt, sich minderwertig zu fühlen oder als minderwertig angesehen zu werden.
Bei Angsterkrankungen ist das Gefühl, das die Gefahr der Entwertung signalisiert, bewusst. Angst bewirkt zweierlei:
Nun ist es nicht einfach das Problem, dass der Angsterkrankte unter Ängsten litte, der Gesunde grundsätzlich aber nicht. Es ist vielmehr so, dass sich der Gesunde anders verhält als der Kranke, sobald er Angst erlebt. Die Formel ist einfach.
| Der Gesunde... | Der Kranke... |
| stellt sich dem Gefühl. | versucht, es zu vermeiden. |
Gewiss: Gefahren zu vermeiden, ist eine Strategie, die im Leben Argumente für sich hat. Es heißt doch: Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn: Wer wagt, gewinnt. Und der psychologische Gewinn, um den es beim Wagnis des Lebens geht, ist der Zugewinn an Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, der dem zukommt, der unangenehmen Gefühlen standhält und Gefahren meistert.
Der pathogene Mechanismus, der die Weiche zwischen gesund und angstkrank stellt, ist die Neigung des späteren Patienten, Situationen vorsorglich zu vermeiden, in denen er Angst erleben könnte. Einerseits tut er das, weil er sich bereits für minderwertig hält und er mit der ungünstigen Einschätzung seines Wertes nicht konfrontiert werden will. Er zieht sich in den engen Horizont seiner Komfortzone zurück und hofft, dass das Leben ihn dort nicht behelligen wird. Andererseits tut er es, weil jenseits der Komfortzone Erfahrungen drohen, die sein wankelmütiges Selbstwertgefühl zusätzlich herabsetzen könnten. An typischen Angsterkrankungen kann der Mechanismus des selbsterzeugten Leidens erläutert werden:
Bei der Generalisierten Angststörung deutet der Patient die Welt als einen Ort, der vor allem durch eine Eigenschaft gekennzeichnet ist: die Gefahr, einen Verlust nach dem nächsten zu erleiden. Aus dem Gefühl heraus, dem Leben nicht gewachsen zu sein, fürchtet er, durch eine Folge immer neuer Niederlagen alsbald aller Werte des Lebens entledigt zu sein: seiner Gesundheit, seiner Liebsten, seines Besitzes, seiner Stellung oder gar des Lebens selbst. Wie die ängstlich-vermeidende Persönlichkeit vermeidet der generell Ängstliche in der Konsequenz Alles und Jedes, was überhaupt eine Gefahr zu enthalten scheint. Indem er das tut, entzieht er sich die Gelegenheit, Ermutigendes zu erfahren. Er kann nicht mehr erleben, dass er Gefahren meistern kann. Stattdessen schürt er seine Angst, indem er sich vorbeugend alles vor Augen führt, wovor man sich ängstigen könnte.
Panik ist ein Zustand, der die gewohnte Handlungsfähigkeit aufhebt. Das ist Grund genug, sie vehement zu fürchten. Solange man Panik empfindet, ist man kaum in der Lage, selbstwirksam und zielgerichtet auf die Wirklichkeit Einfluss zu nehmen; und wer das nicht kann, ist ihr ausgeliefert. Das Vermögen, durch klare Überlegung Überlegenheit zu bewahren ist in der Panik ebenso ausgesetzt wie das Vermögen, durch zielführendes Handeln über sich selbst zu bestimmen. Da das Vermögen, über sich selbst zu bestimmen, ein wesentlicher Grundpfeiler des Selbstwertgefühls ist, nagen wiederkehrende Panikattacken am Selbstwertgefühl wie Termiten am Holz.
Anfangs mögen Panikattacken an bestimmte Situationen geknüpft zu sein, sodass der Kranke versucht, solche Situationen zu umgehen. Mit der zunehmenden Einschränkung seines Bewegungshorizonts, die sich der Kranke als Heilmittel verordnet, sinken aber auch Selbstwertgefühl und -vertrauen, denn der Kranke wird zu jemandem, der nicht mehr all das kann und all das darf, was uneingeschränkten Menschen von Natur aus gestattet ist. Je tiefer das Selbstwertgefühl gesunken ist, desto unscheinbarer werden die Anlässe, die neue Attacken auslösen, also die Erfahrung entsetzter Ohnmacht.
Da ihm auch die Angst als eine der minderwertigen Eigenschaften erscheint, derer er sich zu schämen hat, gerät der Sozialphobiker in einen Teufelskreis. Je mehr er sich davor fürchtet, Zielscheibe der Verachtung zu werden, desto mehr Angst entwickelt er als emotionales Argument um riskante Situationen zu vermeiden. Je mehr Angst er aufbringt, desto mehr fühlt er sich aber mit genau jener Minderwertigkeit behaftet, deren Entblößung ihm unerträglich erscheint. Er ist davon überzeugt, dass sein Wert letztlich von der Wertschätzung abhängt, die er im Umfeld mobilisieren kann und dass er dementsprechend sinkt, wenn das Aufscheinen minderwertiger Eigenschaften das Umfeld dazu bringt, ihm Wertschätzung zu entziehen.
In der Regel erlebt sich der Sozialphobiker als Opfer seiner Angst. Nicht selten steckt hinter der sozialen Phobie aber auch ein narzisstischer Ehrgeiz. Der Phobiker scheut nicht nur vor der Gefahr zurück, durch negative Urteile des Umfelds abgewertet zu werden. Er wünscht zugleich, dass die Urteile besonders positiv sind. Dadurch wird er vom Opfer zum Täter. Statt jedem die Freiheit zu lassen, ihn so zu bewerten, wie er will, versucht er die Meinungen anderer zu steuern, indem er ihnen Informationen vorenthält. Da jedes Lebenszeichen Informationen über den enthält, der das Zeichen von sich gibt, kommt es zu einem innerseelischen Konflikt. Der Ehrgeiz treibt den Phobiker an, sich als besonders wertvoll darzustellen, die Gefahr, dabei zu scheitern, schreckt ihn ab. Sein Ego sagt hü und gleichzeitig hott.
Klassische Ängste
| Ich habe Angst... | Diagnose |
| ausgesetzt zu werden ausgeliefert zu sein |
Agoraphobie |
| eingeengt zu werden entmündigt zu werden an meiner Entfaltung gehindert zu werden |
Klaustrophobie |
| durch Verachtung entwertet zu werden als Verachteter in der Gemeinschaft keinen Platz mehr zu haben |
Soziale Phobie |
| durch den Aufruhr meiner Gefühle entmachtet zu werden | Panikstörung Angst vor der Angst |
Eine wesentliche Aufgabe vor allem der aufdeckenden Komponente der Psychotherapie ist es, dem Angstpatienten aufzuzeigen, wie er durch die Vermeidung unangenehmer Gefühle und Erfahrungen selbst dazu beiträgt, die Abwärtsspirale der Angst in Bewegung zu setzen. Je klarer er sieht, wie er sein Selbstwertgefühl durch eine Methode zu stabilisieren versucht, die langfristig zum Gegenteil führt, desto eher wird er andere Wege gehen. Der andere Weg ist der, sich der Angst vor Entwertung und Niederlage zu stellen.
Die Empfehlungen der Gefühle sind nicht bindend. Sie können individuell interpretiert werden. Bei der Angst sind zwei Interpretationsweisen typisch.
In beiden Fällen fungiert die Angst als Beschützer. Im ersten Fall sperrt sie den Beschützten unter ihrer Herrschaft ein. Im zweiten Fall hilft sie dabei, den Beschützten aus der Not, beschützt zu werden, zu befreien. Angst ist kein Feind. Angst ist nicht schädlich. Es gilt, sie sinnvoll für sich zu nutzen.
Was ist Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeit ist die Fokussierung des Geistes auf das Hier-und-Jetzt. Der aufmerksame Schüler ist im Geiste nicht dort und dann, sondern an der Stelle der Gegenwart, an die das Leben ihn platziert. Er bleibt im Hier und geht mit ihm ins Dann. Er nimmt das Leben an, wie das Leben sich ihm gibt. Er vertraut darauf, dass das Leben ihn in die richtige Zukunft führt, wenn er ihm in der Gegenwart die passenden Antworten gibt. Wann fällt es leicht, sich der Gegenwart zuzuwenden? Wenn sie angenehm ist. Wann ist sie angenehm? Wenn sie eigene Bedürfnisse unmittelbar erfüllt.
Was ist Aktivität? Aktivität ist ein Modus des Daseins, der darauf abzielt, eine vorgestellte Zukunft zu erreichen oder die Gegenwart so zu gestalten, dass sie den eigenen Vorstellungen entspricht. Wann ist der Versuch, eine Zukunft zu erreichen oder die Gegenwart umzugestalten, besonders dringlich? Wenn das Erlebnis der Gegenwart unerfreulich ist.
Die beiden Leitsymptome der ADHS sind eng miteinander verwoben. Das Unvermögen bzw. die fehlende Bereitschaft des ADHS-kranken Patienten im Hier-und Jetzt zu bleiben, hängt von der Qualität seines Erlebens ab. Empfindet er die Gegenwart als angenehm, kann er durchaus darin verweilen. Erlebt er sie als unangenehm, hält er Ausschau nach etwas Besserem. Er träumt sich am Hier-und-Jetzt vorbei. Oder er wird von einer unspezifischen Unruhe erfasst, die ihn irgendwohin drängt; bloß weg von der Stelle, an der er nicht sein will.
Moderne Zeiten
Was zeichnet die heutige Zeit aus? Vieles. Genau: Die moderne Zeit wird täglich komplexer. Um heutzutage einen Beruf zu erlernen, bedarf es weit mehr Aufmerksamkeit als früher. Früher konnte ein angehender Automechaniker die gesamte Technik eines Autos nach relativ kurzer Lernphase verstehen. Ein angehender Automechatroniker von heute versteht die Technik moderner Autos auch dann nur unvollständig, wenn er doppelt so viel lernt. Mit anderen Worten: Die moderne Zeit erzwingt immer mehr Aufmerksamkeit für immer mehr und immer spezifischere Details der Wirklichkeit. Vielen Menschen ist das unangenehm. Sich dieser Herausforderung zu stellen, gelingt ihnen nur mit großer Mühe und sinkendem Erfolg. Solche Menschen sind dafür prädestiniert, eine ADHS zu entwickeln. Je weniger Erfolg sie erleben, desto mehr träumen sie ihn herbei. Je mehr sie träumen, desto weniger Erfolg erleben sie und desto mehr Grund besteht, verstärkt davon zu träumen.
Was sind Projekte? Projekte sind Vorhaben und Wege zum Erfolg. ADHS-Kranke haben meist viele Projekte. Warum? Weil sie möglichst viele Erfolge haben wollen, um die ungeliebte Gegenwart in eine erstrebenswerte Zukunft zu verwandeln. Ein Projekt verheißt einen Erfolg. Drei Projekte verheißen drei Erfolge. Fünf verheißen fünf. Das Problem: Wer fünf Hasen gleichzeitig hinterherläuft, verringert die Chance, einen einzigen zu fangen. Je eiliger man es hat, viele Erfolge zu verzeichnen, desto geringer ist die Chance, dass man auch nur einen einzigen erlebt. Obwohl sich ADHS-Kranke beim Kampf um fünf Erfolge in der Summe mehr anstrengen als Gesunde beim Kampf um einen, bleiben sie in der Bilanz zurück. Das drückt ihr Selbstwertgefühl nach unten. Wer sich und sein Leben aber nicht wertschätzt, kann weder in der Stille noch im Handeln Ruhe finden. Er wird von Impulsen angetrieben, die er nicht versteht. Er unterliegt der Sucht, etwas zu bewirken.
Damit ein ADHS-Kranker sein Problem aus eigener Kraft überwinden kann, muss er verstehen, durch welche Psychodynamik es aufrechterhalten wird. Versteht er die Psychodynamik, wird es ihm leichter fallen, dem Minderwertigkeitsgefühl standzuhalten, das ihn dazu verleitet, aus der Gegenwart zu fliehen.
Depressive Kernsymptome
Während bei Angsterkrankungen die Angst vor dem, was das Dasein des Ängstlichen entwerten könnte, an vorderster Stelle im Bewusstsein steht, wird die Angst beim Depressiven durch die typisch depressiven Kernsymptome verdrängt. Der rein Depressive spürt keine Angst. Vielmehr ist er schwermütig, kann sich zu nichts aufraffen und es fehlt ihm die Zuversicht, dass irgendeine seiner Taten zu einem guten Ende führen könnte.
Betrachtet man die depressive Symptomatik genauer, erkennt man zweierlei:
Nicht umsonst nennt man das depressive Grundgefühl Schwermut. Darin wird der Mut angesprochen. Dem Schwermütigen fällt es schwer, den Mut aufzubringen, sich dem Leben zu stellen. Er ist niedergeschlagen, bleibt lieber gleich liegen. Er trauert um die verlorene Lebendigkeit. Im Wortsinn der Trauer fällt er wie eine Träne zu Boden. Da in seinen Augen die Zukunft sowieso düster sein wird, lohnt es sich nicht, aktiv auf sie zuzugehen. Er hat keinen Antrieb. Der Depressive erlebt ein Stimmungstief. Er wird zu einer Stimmgabel, die nur noch dunkle, niedrige, verlangsamte Frequenzen spürt und von sich gibt.
All das kann als bloßes Defizit verstanden werden. Oder aber, man betrachtet es als eine Maßnahme des Selbstschutzes. Der depressive Symptomenkomplex schickt den Patienten mit dem schwer angeschlagenen Selbstwertgefühl aufs Trockendock. Er wird vor der Konfrontation mit den üblichen Aufgaben des Lebens abgeschirmt und damit auch der Konfrontation mit jenen Aufgaben, bei denen er fürchtet, weitere Niederlagen und damit weitere Infragestellungen seines Wertes hinnehmen zu müssen. Durch den Niedergang seines energetischen Ausdrucks ist er der aktiven Konfrontation mit den Leben enthoben.
Während der rein depressive Mensch keinen Antrieb mehr hat, überhaupt auf Situationen zuzugehen, die sein Selbstwertgefühl weiter gefährden könnten und er daher auch keinen Grund hat, davor Angst zu haben, fühlt sich der Patient mit einer sogenannten agitierten Depression getrieben. Er klagt über innere Unruhe. Diese Unruhe kann zurecht als nur ungenügend verdrängte Angst verstanden werden.
Beim agitiert Depressiven ist der Antrieb durch die Last der Schwermut nicht zum Schweigen gebracht. Er hat Antrieb und damit auch Angst, dass ihn der Antrieb in neue Niederlagen führt; erst recht, weil er keine sinnvollen Ziele sieht, auf die er ihn ausrichten könnte.
Auch bei der Psychotherapie des depressiven Menschen steht die Stabilisierung des Selbstwertgefühls im Vordergrund. Dazu gilt es...
Patienten mit akuter Manie sind psychotherapeutisch kaum erreichbar. Einsicht in die Irrtümer des eigenen Tuns sucht der Mensch in der Regel nur, wenn er darunter leidet und, wenn er überhaupt dazu in der Lage ist, sich selbst in den Fokus der eigenen Wahrnehmung zu rücken. Mindestens eine der beiden Bedingungen ist bei der Manie nicht erfüllt.
Bei der gereizten Manie richtet sich der Kranke mit aller Macht nach außen, um jene Elemente der Wirklichkeit zu überwinden, die er als unbotmäßige Behinderungen seiner Großartigkeit deutet. Wenn jemand einsehen sollte, dass er irrt, dann nicht der Kranke, sondern all die, die seinem Anspruch im Wege stehen.
Erst wenn der Höhenflug vorbei ist und der Patient erschreckt vor dem Schaden steht, den er sich und anderen im Höhenflug zugefügt hat, ist er bereit, sein Erlebnis zu hinterfragen.
Manien treten meist im Wechsel mit Depressionen auf. Man spricht dann von Bipolaren Störungen. Die Psychodynamik der Bipolaren Störung ermöglicht es uns, den engen Zusammenhang zwischen Selbstwertgefühl und psychopathologischem Erleben unmittelbar zu beobachten. Es ist offensichtlich:
Strittig mag es sein, ob es zuerst die Henne oder das Ei ist, was das Erleben bei der Manie bestimmt. Mit der Henne ist der emotionale Aufschwung gemeint, mit den Eiern die passenden Ideen dazu. Der Kranke ist nicht nur euphorisch gestimmt, seine Gedanken fliegen auch zwischen Vorstellungen hin und her, die sein gehobenes Selbstbild zum Ausdruck bringen: Phantasien über eine herausragende Rolle, die er im Leben bereits spielt und/oder über große Pläne, die er alsbald mit Links verwirklichen wird. Unstrittig ist, dass die Qualität der Vorstellungen, die Qualität er Emotionen und das daraus entspringende Verhalten zueinander passen.
Nach dem Höhenflug kommt in der Regel der Absturz in die Depression. Ernüchtert oder gar beschämt stellt der Kranke fest, dass die Vorstellungen, die er sich über seine vermeintliche Großartigkeit machte, Einbildungen gewesen sind. War das Urteil über sich selbst in der Manie kritiklos geschönt, landet es nun auf dem Boden der Tatsachen oder wird gar autoaggressiv, also selbstbestrafend. Der Kranke lässt kein gutes Haar mehr an seinem Leben. Er stempelt sich zum größten Versager ab, schreibt sich jeden erdenklichen Fehler zu, sieht alles schwarz und malt sich eine noch düstere Zukunft aus.
Die Funktion der emotionalen Schwankungen bei der Regulation des narzisstischen Gleichgewichts kann wie folgt beschrieben werden:
In der Manie entzieht sich der Kranke der Erfahrung seiner Selbstwertzweifel indem er sie durch berauschende Ideen aus dem Bewusstsein beseitigt. Bei milden Formen verbleibt das Repertoire der Ideen innerhalb des Horizonts des grundsätzlich Möglichen. So mag es sein, dass ein schüchterner Mann in der Euphorie ein großartiges Selbstbild entwirft. Beflügelt vom Glauben an sein Potenzial versprüht er plötzlich einen Charme, der tatsächlich die Blicke der Frauen auf sich lenkt. Von verlockenden Blicken gestreichelt, schwillt seine Zuversicht dermaßen an, dass er sich in der Rolle eines erotischen Magneten sieht, der auf der Suche nach immer besseren Gespielinnen von nun an eine Schar lechzender Frauenleiber hinter sich lassen wird.
Bei massiven Manien bedient sich die Flucht vor der Minderwertigkeitsbefürchtung auch psychotischer Mittel. Das heißt: Die Größenideen werden manifest wahnhaft. Sie verlassen den Hafen der formalen Logik.
Ein wesentliches Element der Psychotherapie von Patienten mit maniformen Störungen ist es, ihnen die Psychodynamik ihrer Selbstwertregulation aufzuzeigen. Dabei reicht es nicht, eine bloß intellektuelle Erkenntnis der Dynamik zu vermitteln. Es gilt, die Dynamik konkret erkennbar zu machen, indem man gemeinsam biographische Erfahrungen und aktuelle Interaktionsepisoden aufdeckend analysiert. Die Einsicht in die Zusammenhänge ermöglicht dem Patienten zweierlei:
Sich bei aufkommender Euphorie selbststeuernd zurückzuhalten; zum Beispiel zwischenmenschliche Interaktionsfelder zu vermeiden, bei deren Betreten die Gefahr einer Eskalation der Euphorie ins manifest Maniforme droht. Wer den Ball rechtzeitig flach hält, kann verhindern, dass er über die Latte fliegt.
Die paranoide Realitätsdeutung kommt in verschiedenen Ausprägungsgraden vor. In vergleichsweise milden Formen findet man sie bei der Paranoiden Persönlichkeitsstörung. Das Vollbild erscheint als Paranoia bzw. wahnhafte Störung, wobei wohlgemerkt nicht jeder Wahn paranoid sei muss.
Spektrum paranoider Erlebnisweisen
Das Spektrum paranoider Erlebnisweisen ist breit. Es reicht quasi von der Normalpsychologie bis zum paranoide Wahn, der durch keinerlei Argument beeinflussbar das gesamte Denken des Kranken durchsetzt.
Am einen Ende finden wir das, was wir vermutlich alle kennen; zumindest, wenn wir bereit sind, es uns einzugestehen. Auch der normale Mensch hat schnell die üblichen Verdächtigen zur Hand, wenn es darum geht, Missstände zu erklären, die sein Leben verdunkeln: die Gesellschaftsordnung, Regierende und politische Gegner aller Art, die Pharmaindustrie, soziale Gruppen, denen er sich selbst nicht zugehörig fühlt und so weiter und so fort. Selbst das Wetter gerät leicht auf die Anklagebank, wenn der Verursacher von Missmut, Antriebsmangel oder Kopfschmerz dingfest zu machen ist.
Die paranoide Persönlichkeit setzt voreilige Verdächtigung bereits systematischer ein. Wer bemängelt, dass sich ein Hausgenosse, der mit einer solchen Struktur behaftet ist, zu wenig im Haushalt engagiert, bekommt prompt den Vorwurf zu hören, man habe ihm nicht klar genug gesagt, dass er das überhaupt solle. Bei allem, was schiefläuft, sieht die paranoide Persönlichkeit den Fehler grundsätzlich bei anderen; was ihre Beliebtheit langfristig nicht steigert.
Noch krasser wird es beim paranoiden Wahn. Während sich die Unterstellungen der paranoiden Persönlichkeit im Rahmen potenziell realistischer Möglichkeiten bewegen, wirft der Wahnhafte die formale Logik im Dienste des Rechthabens über Bord. Ihn hat man nicht nur versäumt, geduldig und freundlich genug um Mitarbeit im Haushalt zu bitten, er wird vielmehr durch gezielte Bosheiten aus der Nachbarschaft derart behindert, das kein Bitten überhaupt nützen kann. Es sei denn, die Nachbarschaft unterlässt es, ihn durch üble Nachrede, Rufmord, Abhöranlagen, Strahlen oder Gifte zu drangsalieren. Allein: Es liegt an der unerklärlichen Bosheit dieser Leute, dass sie das niemals tun.
Gemeinsamer Nenner der paranoiden Realitätsdeutung ist die Neigung der Patienten, dem Umfeld schädliche Machenschaften zu unterstellen, die ihr Wohlbefinden beeinträchtigen bzw. ihren Erfolg im Leben schmälern.
Leicht erkennbar ist, welchen Effekt die paranoide Unterstellung auf die Selbstwertregulation des Paranoiden hat. Einerseits erlebt er sich ausgeliefert und damit fremden Mächten unterworfen, was sein Selbstwertgefühl eigentlich nur herabsetzen könnte. Im Gegenzug stabilisiert sie es aber auf zweierlei Weise:
Indem er die Missstände seines Daseins nicht etwa als Resultate eigenen Unvermögens deutet, sondern als Ergebnis der unterstellten Machenschaften, spricht sich der Paranoide von jeder Schuld am eigenen Unglück frei. Mit ihm selbst ist alles in Ordnung. Es ist die Übermacht der Bösen, die verhindert, dass er die Rolle im Leben einnehmen kann, die ihm zusteht.
Die psychotherapeutische Beeinflussung paranoider Realitätsdeutungen ist schwierig. Der Paranoide fühlt sich durch sein Muster im Recht. Genau das ist die Aufgabe projektiver Muster: sich im Recht zu fühlen. Sich im Recht zu fühlen, ist ein mächtiger Krankheitsgewinn, der dem Selbstwertgefühl unmittelbar zugutekommt. Während sich der Anwender paranoider Muster systematisch selbst ins Recht setzt, setzt er im gleichen Zuge sein Gegenüber ins Unrecht. Genau das wird er auch mit dem Therapeuten machen; und zwar immer dann, wenn der dem Paranoiden nicht eins zu eins Recht gibt. Wenn der Therapeut aber zum Lager derer gehört, die Unrecht haben, warum sollte der Paranoide dann etwas von ihm annehmen? Mit Ausnahme eben dessen, was seine bisherige Position bestätigt.
Eine direkte Infragestellung paranoider Positionen ist daher meist zum Scheitern verurteilt. Die paranoide Persönlichkeit fühlt sich vom Therapeuten missverstanden. Sie erlebt ihn als jemanden, der sie von oben herab belehren will, als jemanden, der zu Unrecht versucht, sie ins Unrecht zu setzen. Hat der Patient gar einen paranoiden Wahn entwickelt, ist die Gefahr groß, dass er jeden Therapeuten, der dem Wahn frank und frei jede Möglichkeit abspricht, wahr sein zu können, ins Wahngebäude einbaut und ihn zum Komplizen seiner Widersacher erklärt. Dann heißt es für den Therapeuten: Schach matt.
Wagt man sich als Therapeut an den Versuch, paranoide Realitätsdeutungen zu beeinflussen, ist man gut beraten, jedem Disput über die formale Richtigkeit der Inhalte aus dem Weg zu gehen. Zweifellos darf man der eigenen Sichtweise treu bleiben. Man muss nicht in den Vorwurf des Patienten einstimmen, dass dunkle Mächte sein Schlafzimmer verwanzen. Da das Letztere aber möglich ist, sollte man eingestehen, dass der Patient Recht haben könnte.
Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil das Rechthaben die wesentliche Stütze des Selbstwertgefühls des Paranoiden ist. Präsentiert sich der Therapeut als jemand, der erst recht Recht hat, kann er damit nur scheitern. Indem er auf den angeblich konkurrenzlosen Realitätsgehalt seiner eigenen Weltsicht verweist, fordert er vom Patienten das Eingeständnis, im Unrecht zu sein. Gäbe der Patient nach, nähme er den Kollaps seines Selbstwertgefühls in Kauf. Er stünde da wie ein Tölpel, der zu dumm ist, die Welt zu verstehen. Während ein kluger Therapeut hoffentlich weiß, dass er selbst ein Tölpel ist, der die Welt nicht versteht, tut er nichts Gutes, wenn er die gleiche Weisheit vom Patienten verlangt. Weisheit kann man nicht fordern, aber man kann durch Forderungen verhindern, dass sie keimt.
Daher ist es bei der Therapie paranoider Realitätsdeutungen sinnvoll, nicht den Wahrheitsgehalt abzuwägen, sondern Funktion und Wirkung, die das Muster bei der Selbstwertregulation des Patienten hat. Es gilt, ihm die Einsicht zu erleichtern, dass er sich, durch die von ihm rechtmäßig gewählte Sichtweise, Probleme schafft, die er sich nicht zwingend zumuten muss. Es gilt, sein Selbstwertgefühl aufzurichten, damit er die Krücken, die es bislang stützen, fallen lassen kann.
Der süchtige Konsum psychotroper Substanzen kann als Frontalangriff auf unliebsame Gefühle und Stimmungen aufgefasst werden. Das Suchtmittel setzt unmittelbar an den biologischen Strukturen im Zentralnervensystem an, die das Bewusstsein emotional einfärben. Statt wahrzunehmen, wie er die Wirklichkeit tatsächlich erlebt und mit den Urteilen emotional übereinzustimmen, die er spontan über sie fällt, zieht der Süchtige eine Brille auf, die unangenehme Empfindungen durch angenehme ersetzt.
Gefühle und Stimmungen haben jedoch Funktionen. Ihr Endzweck beschränkt sich nicht darauf, ihrem Träger Wohlbefinden zu vermitteln oder Unbehagen zu verpassen. Emotionen (lateinisch: Herausbeweger bzw. Herausbewegungen) steuern Verhaltensweisen. Angenehme Emotionen sorgen dafür, dass bisherige Verhaltensweisen eher beibehalten werden. Unangenehmen Emotionen entspringt der Impuls, Verhaltensweisen zu verändern, um Auswege aus Situationen zu suchen, die als unangenehm erfahren werden.
Beseitigt der Süchtige unangenehme Erfahrungen durch sein Suchtmittel, entfällt der Impuls, reifere Lösungen zu suchen. Seine Kompetenz beim Lösen von Problemen entwickelt sich nicht weiter; abgesehen vom Problem, sich neuen Suchtstoff zu beschaffen. Wohin das führt, ist klar. Es führt dazu, dass die psychosozialen und technischen Kompetenzen des Süchtigen hinter den Kompetenzen suchtfreier Personen zurückbleiben. Über kurz oder lang hat das Auswirkungen auf sein Selbstwertgefühl. Es tritt den Sinkflug an und sorgt dafür, dass der Süchtige - ohne sein Suchtmittel - immer mehr dazu gezwungen wird, die Welt von unten zu betrachten. Das trübt die Stimmung und motiviert ihn dazu, sie durch erneuten Konsum zu heben.
Die blanke Abstinenz ist bei der Suchttherapie zweifellos ein lohnenswertes Ziel. Man kann es durch bloßen Willen und mit Hilfe abstinenzwahrender Therapieangebote erreichen. Dann kann man von dort aus seine Kompetenzen und sein Selbstwertgefühl durch nachhaltigere Mittel als Rauschzustände steigern.
Bei psychischen Erkrankungen gibt es jedoch viel häufiger Überlappungen und Mischformen als in der Körpermedizin. Die Masern sind die Masern und die Mumps ist die Mumps. Psychische Erkrankungen sind kaum je so isoliert voneinander zu betrachten. So kommt es, dass man bei fast jedem Suchtkranken ängstlich-vermeidende, depressive, emotional-instabile, sozialphobische, paranoide, narzisstische, schizoide oder zwanghafte Muster entdecken kann.
Um dauerhafte Abstinenz zu sichern, ist die psychotherapeutische Bearbeitung solcher Muster oft vonnöten: entweder, weil sie nach Abklingen der akuten Entzugserscheinungen in den Vordergrund drängen oder, weil sich der Patient eine Abstinenz überhaupt erst vorstellen kann, sobald er erkennt, dass die entsprechenden Symptome auch ohne Suchtmittel zu überwinden sind.
Nikotinsucht
Die Frage ist berechtigt: Welche erstrebenswerte Substanzwirkung sollte der Raucher eigentlich anstreben, indem er raucht. Während die psychotropen Wirkungen von Alkohol, Opiaten, Benzodiazepinen, Halluzinogenen, Cannabis und Ecstasy eindrücklich sind, sind die Wirkungen des Nikotins eher subtil. Gewiss: Es gibt sie. Gäbe es sie nicht, hätten Nikotinpflaster keinerlei Wirkung.
Andererseits ist die Wirkung der Nikotinpflaster nicht überzeugend. Obwohl sie den Substanzentzug, der beim Nikotin wegen seiner kurzen Halbwertzeit rasch eintritt, zuverlässig verhindern, verhelfen derartige Pflaster nur einer Minderheit der Raucher zu dauerhafter Abstinenz. Da kommt der Verdacht auf, dass die Bindekraft der Nikotinsucht nicht nur der Substanzwirkung geschuldet ist, sondern auch rein psychodynamischen Faktoren.
Rauchen dient nicht nur der Substanzzufuhr. Rauchen ist eine Gewohnheit und ein Ritual. Gewohnheit enthält das Verb wohnen. Wo man wohnt, da ist man zuhause. Wo man zuhause ist, kann man entspannen. Sobald der Raucher seine Gewohnheit aufgibt, gibt er sich der Ungewissheit jenseits der Gewohnheit preis. Grund genug, das Ende des Tabakkonsums auf morgen oder gar Silvester zu vertagen.
Der Vorgang des Rauchens kann auch als Ritual betrachtet werden. Zwecks Ausführung des Rituals unterbricht der Raucher seine bisherige Tätigkeit. Dadurch enthebt er sich dem Netzwerk der profanen Notwendigkeiten, als dessen Erfüller ihn das Lebens zwangsrekrutiert hat. Immerhin fällt auf, dass Rauch bei religiösen Praktiken einen festen Stellenplatz hat. Beim Brandopfer trägt der Rauch die Gabe dem Himmel entgegen. Weihrauch gehört vielerorts zur Liturgie. Millionen Räucherstäbchen verglühen tagtäglich im Umfeld spiritueller Aktivitäten. Festgefügtes aufzulösen und es als Ungeformtes dem Himmel anzuvertrauen, wird dabei als spirituelles Anliegen erahnt und symbolisch vollzogen.
Rituelle Opfer zu vollziehen, hat psychogene Wirkung. Der Appell an die höhere Macht, der dem Ritual inneliegt, entängstigt den, der das Ritual vollstreckt. Angst und Ritual spielen aber auch in der Psychopathologie der Zwangsstörungen eine große Rolle. Der Zwangskranke führt Rituale im Glauben aus, sie seien erforderlich, um Gefahren zu verhindern. Insofern kann auch der Tabakkonsum als Spielart einer Zwangsstörung aufgefasst werden. Was den Raucher bei der Stange hält, ist nicht nur der Vorsatz, dem Zwangsrekrutierten des Daseins eine genüssliche Pause zu gönnen. Es ist auch die unbewusste Angst, dass er Schaden nehmen könnte, wenn er die Verbindung zu den Schicksalsmächten nicht erneuert, die durch das Ritual gefestigt wird. Der Nichtraucher erlebt, wie er dem Leben nackt entgegentritt. Der Raucher bleibt in einen Weichzeichner verhüllt, von dem er sich Schutz erhofft.
Neben den stoffgebundenen Süchten spielen solche, bei denen keine psychotropen Substanzen zum Einsatz kommen, eine immer größere Rolle. Schon lange bekannt sind Mager- und Glückspielsucht. Mit der Erfindung des Computers kamen zwei neue Süchte hinzu: die Computerspielsucht und die Onlinesucht.
Früher war Langeweile ein mächtiger Faktor, der Menschen dazu antrieb, neue Erfahrungen zu suchen. Heute bieten Computerspiele virtuelle Abenteuer, die viele dazu verführen, auf analoge Erfahrungen zu verzichten. Zudem sind Computerspiele so aufgebaut, dass sich die Erfolge, die man dabei erringen kann, schneller einstellen als Erfolge, die man durch Mühen in der analogen Welt erreicht. Die Leichtigkeit des virtuellen Erfolgs im Vergleich zum analogen macht einen großen Teil der Anziehungskraft solcher Spiele aus. Erfolg steigert das Selbstwertgefühl. Je höher das Selbstwertgefühl, desto besser das Befinden.
Beide Süchte sprechen das Geltungsbedürfnis an. Sie befriedigen narzisstische Bedürfnisse. Der siegreiche Held im digitalen Rollenspiel verschafft sich Geltung in den Augen seiner Gilde. Die Onlinesüchtige fühlt sich anerkannt. Je mehr Likes ihre Postings auf sich ziehen, desto mehr fühlt sie sich beachtet, bestätigt und wertgeschätzt. Sich der Befürchtung zu stellen, weniger wert als andere zu sein, also einer Angst, die in jeder Menschenseele lauert, ist Dreh- und Angelpunkt bei der Behebung solcher Süchte. Es gilt, die psychodynamischen Funktionen des Suchtmittels aufzuzeigen und dem Patienten Mut zu machen, die gefürchteten Gefühle anzunehmen.
Die globalisierte Wirtschaft kauft im einen Teil der Welt Arbeit zu Bedingungen ein, die man im anderen niemandem zumuten will oder kann. Für viele heißt das: In der analogen Welt gibt es keinen Platz mehr, auf dem sie eine integrierte Rolle spielen. Hier setzt die soziodynamische Funktion der Online-Angebote ein. Jenen, für die die Gesellschaft keine funktionelle Verwendung mehr hat, bietet sie einen virtuellen Ersatz. Wer weiß, was aus all den umherirrenden Energien würde, gäbe es keine digitale Welt, die sie für ihre Simulationen absorbiert?
Bei der Zwangsstörung steht der Zwang als Symptom zwar im Vordergrund, er ist aber dicht von der Angst gefolgt. Offensichtlich ist es die Funktion des Zwanges, Angst zu beseitigen. Das ist logisch. Etwas zu erzwingen, heißt dafür zu sorgen, dass ein Zustand genau dem entspricht, was derjenige, der den Zwang ausübt, für richtig hält. Wenn die Dinge so sind, wie sie sein sollten, braucht man sich nicht vor Schaden zu fürchten; weil ja alles in Ordnung ist.
Dementsprechend führt der Verzicht auf die Ausführung von Zwangshandlungen zu unangenehmen Gefühlen, als deren führende Qualität Angst zu erkennen ist. Der Kranke hat entweder Angst vor einem bestimmten Unheil oder ein unbestimmtes Angstgefühl, von dem er nicht einmal weiß, worauf es sich richtet, das aber verdrängt werden kann, sobald er die Zwangshandlungen wieder aufnimmt. Dann tut er etwas und wer etwas tut, sorgt doch dafür, dass die Dinge so werden, wie sie sein sollten. Das allein beruhigt. Man kann Angst und Unruhe besser ertragen, wenn man meint, durch eigene Tatkraft unterwegs ins Paradies der absoluten Sicherheit zu sein.
Zwang ist Kampf, ein Kampf um die Kontrolle des Lebens. Bei jedem Kampf geht es um Sieg oder Niederlage. Kampf selbst heißt Unsicherheit und je länger der Sieg auf sich warten lässt, desto ungewisser ist es, ob er jemals eintreten wird. Das mag einer der psychodynamischen Gründe dafür sein, das Angst, also die Furcht vor der Niederlage, im Gefolge einer Zwangsstörung so unbezwingbar wird, dass der Zwangskranke keinen Schritt in die Freiheit mehr wagt. Dann ist er im Zwang gefangen wie ein Übeltäter im Hochsicherheitstrakt. Oder anders gesagt: Dann hält er das Leben im Zwang gefangen, wie einen Übeltäter im Hochsicherheitstrakt. Was auf dasselbe hinauskommt, denn der Mensch hat nicht nur ein Leben. Er ist es.
Was braucht man, um aus einem Gefängnis zu entkommen? Mut. Und zwar nicht nur den Mut, Mauern und Hürden zu überwinden. Dabei riskiert man, von den Wächtern ertappt und zur Verhinderung weiterer Fluchtversuche noch gründlicher sicherheitsverwahrt zu werden. Man braucht vor allem den Mut dazu, frei zu sein. Angst ist der Schwindel der Freiheit. So hat es Kierkegaard formuliert. Wer keine Angst in Kauf nimmt, kann den Weg in die Freiheit nicht finden. Unterwegs in die Freiheit ist man Gefahren ausgesetzt. Einen sicheren Weg zum Ziel gibt es nicht. Erst in der höchsten Freiheit, die man erreichen kann, erlöschen Ängste endgültig.
Das praktische Vorgehen bei der Zwangsstörung setzt auf Einsicht, Konfrontation und Übung.
Ein zweiter Schritt kann es sein, ihm aufzuzeigen, wie das problematische Mittel des Zwangs Unsicherheit schafft und damit zum Auslöser wird, ihn erst recht anzuwenden.
Der vierte Schritt ist die Übung, eigene Gefühle, so wie sie jeweils auftauchen, unabhängig von ihrer Qualität, zu akzeptieren. Dazu gehört auch die Akzeptanz von Impulsen, womöglich sexueller oder aggressiver Natur, auf deren Existenz man mit Angst reagiert, weil sie das Selbstwertgefühl oder die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft gefährden.
Es ist schon viel darüber diskutiert worden, ob Psychopharmaka psychotherapeutische Prozesse fördern oder behindern. Puristen befürchten, die Abschwächung der pathologischen Symptomatik durch Medikamente nehme dem therapeutischen Prozess den Schwung aus den Segeln. Der Patient komme dann nicht mehr an seine wahren Gefühle heran.
Richtig ist, dass Psychopharmaka das emotionale Erleben, also Gefühle und Stimmungen, verändern. Emotionen sind keine rein seelischen Erscheinungen. Das Repertoire der menschlichen Gefühlsreaktionen entstand im Laufe der Evolution; vor allem um psychosoziale Prozesse zu steuern. Es ist genetisch vorgegeben und somit körperlich verankert. Wie alle psychoaktiven Substanzen setzen Psychopharmaka am Körper an. Sie verändern die Intensität und gegebenenfalls die Qualität von Gefühlen, mit denen der Organismus das bewusste Ich konfrontiert.
In wie weit sich ein Ich von den Emotionen steuern lässt, die in seinem Bewusstsein erkennbar werden, hängt von der Ich-Stärke ab; also von seinem Anspruch, selbstbestimmt zu handeln. Das schwache Ich handelt automatisch, das starke autonom.
Psychisch kranke Menschen fühlen sich oft so schwach, dass sie davon ausgehen, nicht in der Lage zu sein, unabhängig vom Diktat ihrer Emotionen handeln zu können.
Kurzum: Viele Menschen werden durch die Übermacht ihrer Gefühle vereinnahmt. Treten heftige Gefühle auf, sind sie kaum noch in der Lage, aus eigener Kraft etwas zu tun, um ihre Lebenslage zu verbessern. Genau das färbt ihr negatives Selbstbild immer dunkler ein und kann verhindern, dass sie psychotherapeutisch wirksame Schritte machen. Hier können Psychopharmaka nützlich sein. Psychopharmaka können die Intensität lähmender Gefühle soweit abschwächen, dass der Kranke den Mut findet, selbstbestimmt zu handeln.
Dass die medikamentöse Behandlung seelischer Störungen das Risiko beinhaltet, sich unerwünschte Nebenwirkungen einzuhandeln, ist allgemein bekannt. Auch aus diesem Grund entscheiden sich viele Patienten von vornherein für eine Psychotherapie. Dabei wird meist übersehen, dass auch eine Psycho- bzw. Verhaltenstherapie gegebenenfalls schaden kann:
Gerade bei tiefenpsychologisch ausgerichteten Therapien wird darauf hingearbeitet, Dinge bewusst zu machen, die es bis dahin nicht waren. Meist öffnet das den Weg zu mehr innerer Klarheit. Es können aber auch Erinnerungen auftauchen, deren Verdrängung sehr gute Seiten hatte. Gelingt es dem Patienten nicht, solche Inhalte in ein neues Selbstbild zu integrieren, kann das dazu führen, dass es ihm nach der Therapie schlechter geht als davor. Im schlimmsten Fall können Depressionen, Angststörungen oder gar Psychosen ausgelöst werden.