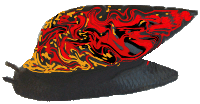
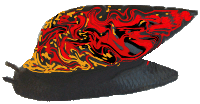
Je einseitiger eine Substanz einen Pol im Spannungsfeld des psychologischen Grundkonflikts bedient, desto schneller macht sie den süchtig, dessen entsprechendes Bedürfnis unerfüllt ist.
Gewiss: Thematisch hat Sucht mit Suche zu tun; allerdings einer an der falschen Stelle. Der Konsument (lateinisch consumere = aufnehmen, verwenden, verbrauchen) sucht wie jeder andere auch. Er sucht nach Glück, Entspannung, Angst- und Sorgenfreiheit, befreitem Kontaktverhalten und Selbstwertgefühl. Sobald er aber die Substanz gefunden hat, die ihm das gesuchte Gefühl als Rausch vermittelt, hört er mit der Suche auf... und konsumiert stattdessen seinen Retter in der Not.
Da die Suche des Süchtigen an der Substanz endet, hat die Sprache gut daran getan, den Begriff Sucht nicht in Ableitung des Verbs suchen zu bilden. Sie entschied sich für das Verb siechen. Offensichtlich sah sie das Dahinsiechen derer, die die Suche nach eigenen Mitteln zur Freisetzung ihrer Persönlichkeit zugunsten von Suchtmitteln allzu früh aufgeben.
Stoffe mit Suchtpotenzial verändern das Bewusstsein. Sie verändern die Wahrnehmung sowie die Bewertung der eigenen Person und der Umwelt. Deshalb nimmt man sie ein. Wer Suchtmittel einnimmt, erzeugt eine künstliche Psychose. Er erwartet, dass er die Dinge mit verändertem Bewusstsein gelassen hinnimmt oder dass er besser als im nüchternen Zustand handeln kann.
Suchtmittel haben unterschiedliche Wirkungen. Von ihrem Konsum gehen unterschiedliche Risiken aus. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick.
Typische Wirkungen suchterzeugender Substanzen
| Substanz | Subjektives Erleben | Körperliche Symptome | Komplikationen |
| Opiate, Heroin, Morphium | Wärmegefühl, Entspannung, Gefühl der Geborgenheit, Apathie, Dämpfung des Schmerzempfindens, Abschirmung gegen Außenreize, behagliches Tagträumen | Enge Pupillen, Verlangsamung, verwaschene Sprache, Übelkeit, Erbrechen, Blutdrucksenkung | Verengung des Interessenhorizonts auf Opiatkonsum, soziale Depravation, körperliche Abhängigkeit |
| Tranquilizer, Hypnotika, Benzodiazepine | Entspannung, Entängstigung, Müdigkeit Auch paradoxe Wirkung mit Enthemmung und Erregung möglich |
Verwaschene Sprache, psychomotorische Verlangsamung, Gangstörungen, muskuläre Entspannung | Körperliche Abhängigkeit mit Entzugspsychosen und epileptischen Anfällen |
| Cannabis, Haschisch, Marihuana | Entspannung, Intensivierung der Selbstwahrnehmung, Tagträumen, Passivität | Mundtrockenheit, Cannabisgeschmack, gesteigerter Appetit, beschleunigter Puls, Lust auf Süßes. | Demotivationales Syndrom, Umschlag in akute oder chronische Psychosen |
| Kokain | Enthemmung, gesteigertes Selbstwertgefühl, gesteigerter Antrieb, sexuelle Erregung, Größenideen | Weite Pupillen, beschleunigter Herzschlag, Blutdrucksteigerung, Schwitzen | Umschlag in paranoide Ängste und wahnhafte Verkennungen, Depressionen bei Substanzmangel |
| Amphetamine, Speed | Vermehrter Antrieb, verbesserte Konzentrationsfähigkeit, verminderte Ermüdbarkeit, gesteigerte Leistungsfähigkeit | ähnlich Kokain | ähnlich Kokain |
| Entactogene, Extacy (Ecstasy), MDMA | Gesteigerte Kontaktbereitschaft, Gefühle mystischer Verbundenheit | ähnlich Kokain | ähnlich Kokain |
| Halluzinogene, LSD, Psylocybin, Meskalin | Intensivierung der sensorischen Wahrnehmung, Veränderungen des Raum- und Zeiterlebens, Halluzinationen | Weite Pupillen, beschleunigter Puls, Zittern, vegetative Übererregung | Umschlag in paranoide Verkennungen und akute Angstpsychosen (Horrortrip). Chronische Psychosen |
| GHB, GBL Gamma-Hydroxybutyrat Gamma-Butoyrolacton Liquid Ecstasy (KO-Tropfen) |
niedrige Dosis: enthemmend, leicht euphorisierend hohe Dosis: sedierend, einschläfernd bis zu narkotischem Schlaf |
Verwaschene Sprache, psychomotorische Verlangsamung, Gang- und Koordinationsstörungen | psychische und körperliche Abhängigkeit, Filmriss, im Entzug Unruhe, selten Halluzinationen und Krampfanfälle | Alkohol | Je nach Menge und individueller Neigung: Enthemmung mit gesteigerter Kontaktbereitschaft, Entängstigung, erhöhte Risikobereitschaft, Reizbarkeit, Aggressionsdurchbrüche | Verlangamung, lallende Sprache, Gangstörungen, fahrige Bewegungen, verlangsamter Lidschlag | Körperliche Abhängigkeit mit Delirium tremens und epileptischen Anfällen im Entzug, Korsakow-Syndrom, Alkoholhalluzinose, Alkoholdemenz |
Spezielle Risiken
Soziale Depravation
Der Opiatsüchtige wird seines sozialen Umfelds beraubt. Zumindest brechen soziale Kontakte zum nicht-süchtigen Umfeld ab.
Demotivationales Syndrom
Chronische Cannabiskonsumenten haben nur noch wenig Motivation, sich den Lebensaufgaben zu stellen. Nicht alle, aber viele Kiffer verwandeln sich in sogenannte Couch-Potatoes. Sie sitzen viel herum und packen wenig an.
Cannabis-Hyperemesis-Syndrom (CHS)
Eigentlich wirkt Cannabis antiemetisch. Es hemmt also den Brechreiz. Bei Dauerkonsum hoher Dosen kann es gegenläufige Effekte haben und zu einem hyperemetischen Syndrom führen. Dabei kommt es tagelang zu Oberbauchbeschwerden und heftigem Erbrechen, das nur durch THC-Entzug zu stoppen ist.
Die Muster des Suchtmittelkonsums sind uneinheitlich. Sie hängen von äußeren Umständen, der Persönlichkeit des Konsumenten und von dessen Zielsetzung ab. Tatsächlich ist beim Konsum bewusstseinsverändernder Substanzen ein Kontinuum tausender ineinander übergehenden Varianten festzustellen. Um einen Überblick zu bekommen, macht eine Unterteilung in vier Grundmuster Sinn.
Die vier Muster unterscheiden sich bezüglich ihrer psychologischen und biographischen Konsequenzen und damit einhergehend bezüglich des Nutzen-Risiko-Gefälles.
Kontrollverlust
Die Mehrzahl der Menschen geht mit bewusstseinsverändernden Substanzen kontrolliert um. Kontrolliert ist der Umgang, wenn er keine Dynamik anstößt, die die Neigung zum Konsum verstärkt. Besteht Kontrollverlust, wird das Bewusstsein durch den Konsum so verändert, dass der Süchtige mehr konsumiert, als er eigentlich vorhatte und/oder als er im Nachhinein gutheißen kann.
Übergänge
Je mehr eine Substanz dazu dient, positive Entwicklungen anzustoßen, desto eher ist es Gebrauch. Je mehr eine Substanz dazu dient, unangenehme Erfahrungen zu vermeiden, desto eher ist es Missbrauch.
Missbrauch
Suchtstoffe erleichtern es, unangenehme Bewusstseinsinhalte zu verdrängen. Unangenehmes gerät vorübergehend in Vergessenheit. Das ist die angestrebte Wirkung. Missbrauch betreibt, wer unangenehme Themen mit Betäubungsmitteln so aus dem Bewusstsein verdrängt, dass er damit den Impuls schwächt, Lösungen durch selbständiges Handeln zu finden.
Eine Substanzerfahrung ist bereichernd, wenn das Erlebte als Leuchtturm dient, der dem Konsumenten den Weg zu sich selbst anzeigt. Eine Substanzerfahrung ist irreführend, wenn der Konsument glaubt, gesteigerter oder wiederholter Konsum könne als Weg dorthin dienen.
Zwei Muster des Rauschs
Schränkt ein Rausch Denkvorgänge ein, führt das zu einer Rückkehr ins Hier-und-Jetzt. Beflügelt er das Denken, reist der Berauschte ins Land der Phantasie.
Eine Substanzerfahrung liegt nach einmaligem Konsum vor. Sie vermittelt ein Erleben der bewusstseinsverändernden Wirkung der Substanz und somit einen Einblick in die substanzspezifische Veränderung des Erlebens. Die Substanzerfahrung kann zufällig oder gezielt erfolgen. Kommt es im Rahmen einer Substanzerfahrung nicht zu folgenschweren Komplikationen, kann sie unproblematisch oder gar bereichernd sein.
Eine Substanzerfahrung ist bereichernd, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Drogen- bzw. Alkoholgebrauch liegt vor, wenn ein wiederholter Konsum dazu eingesetzt wird, das Leben in einer gezielten Weise zu gestalten, ohne dass die Lebensgestaltung durch den Konsum erkennbare Schäden erleidet. Auch Substanzmittelgebrauch kann bereichernd sein; solange der Konsument nicht der Versuchung unterliegt, Menge und Konsumfrequenz der eingesetzten Stoffe zu steigern, um unliebsame Gefühle und Stimmungen grundsätzlich aus seinem Erleben zu verbannen.
Missbrauch liegt vor, wenn das Suchtmittel gezielt dazu eingesetzt wird, unangenehmen oder gefürchteten Erlebnissen aus dem Wege zu gehen; und zwar so oft, dass es durch die Vermeidung der gefürchteten Erfahrungen zu einer Störung der psychologischen Reifung kommt.
Süchtig ist ein Substanzkonsum...
Konsumvarianten - Unterschiede und Gemeinsamkeiten
| Erfahrung | Gebrauch | Missbrauch | Sucht | |
| Rolle der Substanz | Mittel zur zufälligen oder angestrebten Erweiterung des Erfahrungsschatzes | Kontrollierter Konsum zur gelegentlichen Steuerung von Erlebnisweisen: maßvolles Trinken um auf der Party locker drauf zu sein, mal einen Joint rauchen um zu entspannen oder tagzuträumen, vor dem Staatsexamen kurzfristig Amphetamine einsetzen, um besser für die Prüfung lernen zu können | Stereotyper Einsatz zwecks Vermeidung spezifischer Erlebnisse: ständiger Einsatz von Tranquilizern zur Angstreduktion, sich Mut antrinken, regelmäßiger Alkoholkonsum, um überhaupt abschalten zu können |
Beherrschender Inhalt der Lebensgestaltung |
| Risiken | gering
Jede Erfahrung, auf die man sich einlässt, birgt Risiken. Wer Ski fährt, kann sich das Genick brechen. Wer Alkohol trinkt, kann sich im Rausch gefährden. Wer LSD ausprobiert, kann auf Dauer psychotisch werden. Wer Kokain schnupft, kann im Größenwahn vors nächste Auto laufen. |
mäßig
Zusätzlich zu den Risiken der einmaligen Substanzerfahrung birgt jeder Substanzgebrauch das Risiko eines Übergangs in Missbrauch und Sucht. |
hoch
Störung der Persönlichkeitsentwicklung, Übergang in körperliche Abhängigkeit |
sehr hoch
Biographisches Scheitern, sozialer Niedergang, körperliche Folgeschäden, erhöhte Sterblichkeit |
| Vorteile | Erweiterung des Bewusstseins durch Öffnung neuer Wahrnehmungshorizonte, mitreden können | Vereinfachung der Lebensgestaltung durch Einsatz hilfreicher Substanzen, Erweiterung der Erlebnismöglichkeiten | Rasch wirksames Regulativ
Gefürchtete Erlebnisweisen können, wenn man sie tapfer durchlebt, dem Selbstbewusstsein Schub verpassen. Sind sie aber unausweichlich und können sie nicht positiv bewältigt werden, kann daraus großer Schaden entstehen. Von Fall zu Fall könnte es daher das kleinere Übel sein, eine Substanz zu missbrauchen als einen Schaden in Kauf zu nehmen, den man nicht verkraften kann. |
Pathologische Vorteile
Die Vorteile der Sucht sind allenfalls pathologisch. Sucht kann eine subjektiv nützliche Erklärung dafür sein, warum man eigene Ziele nicht erreicht. Die Rolle des Kranken, die man als Süchtiger übernehmen kann, bietet ihrerseits Vorteile: Zuwendung professioneller Helfer, Entbindung von sozialen Pflichten, staatliche Fürsorge. |
| Wirkung auf Breite des Bewusstseins | erweiternd | neutral
Während die Substanzerfahrung erweiternd auf das Bewusstsein wirkt, indem sie neue Ebenen der Wahrnehmung erkennbar macht, kommt durch den gewohnheitsmäßigen Gebrauch in der Regel keine zusätzliche Erweiterung mehr zustande. Die Wirkung auf die Breite des Bewusstseins ist neutral. Der Konsument bewegt sich jedoch in einem erweiterten Erlebnisfeld. So erleichtert es ihm Alkohol womöglich, an einer Geselligkeit teilzunehmen, für deren Ausgelassenheit er ohne Alkohol zu nachdenklich wäre. |
einschränkend
Wer Suchtmittel missbraucht statt Gefürchtetes aus eigener Kraft zu bewältigen, verzichtet darauf, sich durch wachsendes Selbstvertrauen neue Horizonte zu eröffnen. Der Missbrauch beschränkt sein seelisches Wachstum. |
verengend
Der Horizont des Süchtigen verengt sich zunehmend auf wenige Themen: Wie komme ich an den Stoff? Wie kann ich meinen Konsum verbergen oder rechtfertigen? Wie komme ich von der Sucht wieder los? |
Von Sucht bedroht ist vor allem, wer beim Lösen seiner Probleme ineffektive Verhaltensweisen nutzt. Dazu gehören abhängige, depressive, ängstlich-vermeidende, emotional-instabile oder andere problematische Muster.
Diese Muster führen dazu, dass man bei der Vertretung seiner Interessen hinter dem Notwendigen zurückbleibt. Dadurch stauen sich Wut, Angst und Unzufriedenheit auf, was einen wachsenden Handlungsdruck bewirkt. Eigentlich müsste man etwas tun, um die Probleme zu lösen. Entweder weiß man aber nicht was oder es fehlt der Mut dazu. Daraus resultieren Schuld- und Schamgefühle.
Sobald man bemerkt, dass eine Substanz den Leidensdruck mindert, ist man versucht, das Mittel öfter einzusetzen. Tut man es, verfällt man bezüglich des verdrängten Problems in Passivität. Man wächst nicht mehr daran. Man lernt im Umgang damit keine neuen Strategien. Man verlernt womöglich auch noch das, was man bereits konnte.
Der Teufelskreis beginnt sich zu schließen. Je mehr man hinter dem Notwendigen zurückbleibt, desto mehr fühlt man sich von Notwendigkeiten bedrängt. Es droht zunehmender Kontrollverlust. Die Substanz nach der man süchtig wird, erscheint als einziger Retter in wachsender Not. Dabei ist der Griff nach dem Retter genau das, was die Not vertieft.
Abkürzung oder Umweg
Wie man sich fühlt, hängt zu jedem Zeitpunkt auch von Umständen ab, die man nicht unmittelbar beeinflussen kann:
Das Befinden ist abhängig. Der Konsum von Suchtstoffen ist ein Versuch, sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen, indem man das Befinden durch ein chemisches Werkzeug selbst bestimmt. Setzt man das Mittel zu oft ein, befreit man sich nicht aus der Abhängigkeit. Man verstrickt sich tiefer in sie hinein. Die Abkürzung wird zum Umweg.
Die verführerische Wirkung des Alkohols liegt in einer Störung der Gedächtnisfunktion. Die Bedeutung von Gedächtnisinhalten bezüglich der Realitätsdeutung wird ausgeblendet. Man trinkt, um zu vergessen:
Stufengrade des Vergessens
Das Grundwort im Verb vergessen geht auf die indoeuropäische Wurzel ghed = fassen, ergreifen zurück. Vergessen heißt nicht mehr zugreifen. Demselben Stamm entspringt das englische to get = bekommen. Alkoholbedingtes Vergessen vollzieht sich in zwei Stufen:Je mehr der Alkohol die Hirnsubstanz schädigt, desto weniger kann der Trinker noch zugreifen; selbst wenn er es versuchte. Aus dem gewünschten Vergessen wird ein Unvermögen zur Erinnerung.
Durch die Wirkung der Substanz verengt man das Bewusstsein auf eine vereinfachte Gegenwart und setzt den Kreislauf der Sucht in Gang.
Statt aus unliebsamen Erfahrungen zu lernen, blendet man die Erinnerung daran aus. Hat man dank des Alkohols vergessen, wie man sich missachtet, ungeliebt und wertlos fühlte, fürchtet man sich weniger, dass es erneut passiert und ist in der Folge enthemmt. Erfahrungen, die man ausblendet, kann man aber nicht für künftiges Wachstum nutzen. So bremst man die eigene Reifung aus und sorgt dafür, dass man sich auch in Zukunft missachtet und wertlos erlebt.
Will man von den Sorgen der Zukunft nichts wissen, lässt Alkohol die Erinnerung daran verblassen. Wer trinkt weiß, dass er sich wegen des Trinkens dem nächsten Tag nur angeschlagen stellen kann. Also ist der nächste Tag erst recht zu fürchten und der Trinker trinkt noch ein Glas, um genau das zu vergessen. So entsteht Kontrollverlust. Man trinkt, um zu vergessen, dass man das Trinken bereuen wird. Hat man sich durch den nächsten Tag in den Abend gerettet, will man im nächsten Umtrunk vergessen, dass der folgende Tag ebenso unerfreulich sein könnte.
Konsumiert man große Mengen, kommt es zum Filmriss. Die Erinnerung an den Abend wird über Nacht gelöscht. Trinkt man dauerhaft, führt der fortgesetzte Versuch, das Gedächtnis abzuschwächen, zu einer dauerhaften Störung seiner Funktion. Man spricht von einem Korsakow-Syndrom. Dabei handelt es sich um einen meist unumkehrbaren Verlust der Merkfähigkeit mit entsprechenden Orientierungsstörungen.
Ursache aller Abhängigkeit ist der Glaube, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen, um man selbst zu sein. Man ist man selbst, wenn man den Platz in der Ordnung der Wirklichkeit einnimmt, dessen Position durch das Wesen des Selbst bestimmt ist. Man ist nicht man selbst, wenn man Rollen zu spielen versucht, die der tatsächlichen Position in der Wirklichkeit nicht entsprechen.
Die Person ist die Erlebnisform, die in der Polarität dualer Gegensätze (gut-schlecht, günstig-ungünstig, richtig-falsch) steht. Das Selbst ist die Erlebnisform, die dieser Polarität vorausgeht und enthoben ist. Sobald das Ich sich mit der Person gleichsetzt, erlebt es sich dualen Gegensätzen ausgeliefert und damit abhängig von den Bedingungen, die es als unentbehrlich für das Wohl der Person empfindet.
Manche Suchtstoffe führen zu strukturellen Veränderungen am Körper. Oder der Organismus reagiert auf die ständige Reizung durch die Substanz mit einer Umstellung von Stoffwechselprozessen. Eine körperliche Abhängigkeit ist entstanden. Zu den Substanzen, die dazu führen, gehören vor allem Alkohol, Opiate und Tranquilizer.
Toleranzentwicklung
Unter einer Toleranzentwicklung versteht man die zunehmende Fähigkeit des Konsumenten wachsende Substanzmengen zu verkraften; und im Umkehrschluss mehr Substanz zu benötigen, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Ursache sind Anpassungsmaßnahmen des Körpers. Dieser versucht, den chemischen Eingriff durch Gegenmaßnahmen auszugleichen. Die Toleranzentwicklung ist die eigentliche Ursache der körperlichen Abhängigkeit.
Wird der Suchtstoff entzogen, entgleist das krankhafte Gleichgewicht. Das kann zu heftigen Entzugserscheinungen führen. Vor allem beim Alkohol können sie unbehandelt tödlich enden. Die Angst vor den Entzugserscheinungen vertieft die Abhängigkeit des Süchtigen von seiner Substanz. Bevor das Zittern anfängt, öffnet er die nächste Flasche.
Geht dem Trinker der Alkohol aus, fällt die dämpfende Wirkung weg. Entzugserscheinungen treten auf. Sie sind Ausdruck einer überschießenden Erregung des Organismus, der nach Wegfall der Dämpfung Zeit braucht, um sich wieder umzustellen.
Bei starker Abhängigkeit beginnen Entzugserscheinungen bereits wenige Stunden nach dem letzten Konsum; selbst dann, wenn noch relativ hohe Alkoholmengen im Blut vorhanden sind. Nach 3-7 Tagen klingen sie in der Regel vollständig ab.
Opiate, allen voran Heroin, blockieren sogenannte Nocizeptoren. Nocizeptoren sind Schadensmelder (lateinisch nocere = schaden). Sie melden dem Gehirn, dass etwas nicht in Ordnung ist, meist in Form von Impulsen, die das Gehirn dem Bewusstsein als Schmerzerlebnis zur Verfügung stellt. Neben dem Schmerz blockieren Opiate auch das Empfinden von Hitze, Kälte, Spannung, Angst, Hunger und Unbehagen.
Namen
Der Begriff Opiat verrät wenig über seine Wirkung: Er ist von griechisch opos [οπος] = Pflanzensaft abgeleitet. Im Gegensatz dazu soll der Name des Heroins vielsagend sein. Es heißt, es verdanke ihn seiner blockierenden Wirkung auf Nocizeptoren. Heroin gehe auf Griechisch heros [ηρως] = der Held zurück. So mancher Soldat habe mit blockierten Nocizeptoren heroische Taten vollbracht, auf die er sich ohne Blockade des Schmerzempfindens nicht eingelassen hätte. Eine andere Deutung geht davon aus, die Substanz selbst habe als heldenhaft gegolten, weil sie wie ein heroischer Beschützer alle Leiden selbstlos zu vertreiben versprach.
Wie beim Alkohol reagiert der Körper auf die Gegenwart der Opiate mit Gegenmaßnahmen. Er versucht die Blockade der Schadensmelder zu überwinden. Dazu sendet er verstärkte Impulse ans Gehirn. Kann der Süchtige keinen Stoff mehr beschaffen, fällt die Barrikade vor der überlauten Schadensmeldung weg. Das Bewusstsein wird mit negativen Nachrichten aus dem Körper überschwemmt. Resultat sind die typischen Entzugserscheinungen des Opiums. Der Zeitverlauf der Entzugserscheinungen ähnelt dem des Alkohols.
Tranquilizer (lateinisch tranquillitas = Ruhe) vom Typ der Benzodiazepine wirken auf das sogenannte GABAerge System im Gehirn. Dadurch wirken sie dämpfend. Sie mildern Angst, Wut und Erregung. Sie dämpfen die Wachsamkeit. Der Konsument nimmt gelassen hin, was ihn sonst aus der Fassung brächte. Er ist beruhigt.
Auch hier kommt es bei dauerndem Gebrauch zu Gegenmaßnahmen des Körpers. Der Körper weiß, dass Wachsamkeit sinnvoll und es durchaus nicht immer ratsam ist, alles gelassen hinzunehmen. Daher versucht er, den Substanzmissbraucher aus seiner Fügsamkeit zu scheuchen. Fällt die Substanz weg, ist der Weckreiz des Körpers übergroß. Folgendes hat der Süchtige womöglich zu erdulden:
Beim Entzug stimulierender Substanzen wie Kokain und Amphetamin (z.B.: Crystal Meth) stehen psychische Symptome im Vordergrund. Der Entzug wirkt wie die Kehrseite der Substanzwirkung. Während die Substanzen euphorisch machen, das Gefühl vermitteln, über gesteigerte Kraft und Dynamik zu verfügen, zu gesteigerter Aktivität führen und das Schlafbedürfnis reduzieren, ergeht es dem Konsumenten im Entzug umgekehrt.
Statt euphorisch ist er depressiv, statt aufgedreht wird er antriebslos, statt hellwach zu sein, plagt ihn lähmende Müdigkeit. Die größte Gefahr besteht darin, dass der Verlust des geborgten Selbstwertgefühls in eine Depression mündet, in der sich der Patient umbringt. Ist sich der Süchtige der Gefahr suizidaler Impulse bewusst, ist das Risiko einer Umsetzung gering.
Die Entzugserscheinungen bei chronischem Cannabiskonsum sind selten spektakulär oder gar gefährlich. Trotzdem kann es einem Konsumenten schwerfallen, von seiner Droge abzulassen. Bei chronischem Konsum steht meist die entspannende und schlaffördernde Wirkung im Vordergrund. Fällt die Droge weg, wird der Konsument überempfindlich, reizbar und unzufrieden. Er kann nicht mehr abschalten, schläft schlechter und fühlt sich durch die nüchterne Aufdringlichkeit der Außenwelt bedrängt.
Gamma-Hydroxybutyrat wirkt im Grundsatz sedierend wie Tranquilizer. Bei körperlicher Abhängigkeit kommt es im Entzug zu starker Unruhe, Angst, Schlafstörungen, manchmal zu epileptischen Anfällen und/oder Entzugspsychosen.
Suchtstoffe vermitteln unterschiedliche Gefühle. Großen Einfluss auf die Substanzwahl hat die persönliche Stellung des Konsumenten im Grundkonflikt. Nicht bei allen Substanzen entspricht die Wirkung so deutlich wie bei Opiaten und Kokain dem Bedürfnis nach beruhigender Zugehörigkeit bzw. ungehemmter Handlungsmacht.
Große Welt große Angst
Kleine Welt kleine Angst
Die Welt um den Tresen reicht bis zur Kneipentür, die neben dem Spritzbesteck endet an der Haut. Wer sich eine Nase zieht, fühlt sich durch den Stoff so groß, dass ihm die Welt klein erscheint.
Das Zusammenspiel zwischen der Wirkung von Alkohol, Cannabis, Tranquilizern und Drogen wie LSD oder Extacy einerseits und der Psyche des Konsumenten andererseits lässt sich nur ungenau skizzieren. Auch die Psychodynamik des Opiat- und Kokainkonsums weist individuelle Varianten auf, die nur bei Betrachtung des Einzelfalls zu verstehen sind. Trotzdem gibt es typische Konstellationen:
Die Wirkung des Alkohols ist vielschichtig. Sie bedient sowohl das Bedürfnis nach Zugehörigkeit als auch das nach Selbstbestimmung.
Alkohol verengt das Bewusstsein auf das Hier-und-Jetzt. Er blendet die anonyme Weite des Daseins aus und erleichtert es dem Trinker, sich in einer vereinfachten Gegenwart heimisch und vertraut zu fühlen. Das erfüllt zwar das Bedürfnis nach Zugehörigkeit noch nicht, es mildert jedoch die Angst vor der Verlorenheit.
Indem Alkohol die Sorge vor dem, was kommen mag, vergessen lässt, setzt er Impulse frei, sich ohne Skrupel auszudrücken. Mit Alkohol im Blut ist man enthemmt. Man erspart es sich, bei allem, was man sagt und tut, zu überprüfen, ob es auch den anderen passt. Der Mut, im vertrauten Horizont der Trunkenheit selbstbestimmt über eigene Rede und Tat zu entscheiden, führt dazu, dass die Entfremdung von den anderen, die durch Angst vor Ablehnung entstand, entfällt. Wie ein kleiner König, der alles sagen darf, fühlt man sich dem Kreis sorgloser Genießer zugehörig.
Wahrnehmung, Geselligkeit, Verbrüderung
Alkohol trübt die Unterscheidungskraft. Erkannte man von einer Struktur vor dem Konsum siebzehn Elemente, sieht man danach nur noch sechs. Feinheiten verschwinden aus dem Blickfeld. Unterschiedliches wird als ähnlicher eingeschätzt als bisher. Das führt zu zweierlei:
Distanzen zwischen Personen verblassen. So fällt es leichter, sich anderen zugehörig zu fühlen. Auf dem Betriebsfest rückt man Leuten näher, zu denen man bislang Abstand hielt. Wenn es krass kommt, wacht man morgens in einem Bett auf, in dem man noch nie geschlafen hat.
Urteile über komplexe Sachverhalte werden unter Alkoholeinfluss vereinfacht. Wo man nüchtern Details erkennt und Meinungsunterschiede betont, einigt man sich im Rausch darauf, dass alles eigentlich ganz einfach ist.
Alkohol kann aber auch Impulse freisetzen, die Zugehörigkeiten ignorieren; und die dem von seiner Angst befreiten Trinker Taten erlauben, von deren Selbstbestimmtheit er hinterher nichts mehr wissen will.
Die Wirkung der Opiate ist einseitiger als die des Alkohols. Opiate vermitteln fast ausschließlich ein Gefühl geborgener Zugehörigkeit.
Opium und seine Derivate wirken schmerzlindernd, einlullend und wärmend. Unter Opiateinfluss erlebt sich der Süchtige geborgen wie im Schoß einer Mutter, die ihn vor dem gefürchteten Kampf um Selbstbestimmung bewahrt. Da keine Störmeldung mehr das Bewusstsein des Träumers erreicht, erlaubt er sich, ungestört vom Ruf der Probleme nach aktiver Lösung, passiv zu sein.
Dementsprechend entwickelt man im Opiatrausch kaum jemals Tatendrang. Solange die Wirkung anhält, döst und träumt man vor sich hin. Es kommen kaum noch Impulse auf, Zugehörigkeit im Kontakt zu andern zu suchen. Das Bedürfnis danach ist durch die Droge gestillt. Warum sollte man sich also auf dem steinigen Weg der Realität um eine echte Bezogenheit zu anderen bemühen?
Lässt die Wirkung aber nach, prasseln die verdrängten Hiobsbotschaften wieder auf den Konsumenten ein. Sie lassen ihn mit wachsender Getriebenheit nach der nächsten Mutter Ausschau halten, die ihm ein paar Stunden sorglose Kindheit gewährt.
Opiate sind illegal. Daher ist die Außenwelt für den Konsumenten umso mehr feindliches Gebiet. Je mehr er sich bei der Beschaffung der chemischen Mutter die Haut an Realitäten zerkratzt, desto süchtiger sehnt er die schmerzlindernde Wirkung der Droge herbei. Die starke Suchtpotenz der Opiate entsteht aus der einseitigen Polarität zwischen der Hetze des Ausgeliefertseins an eine erschreckende Außenwelt und der gefühlten Geborgenheit, die die Droge vermittelt.
Die Wirkung des Kokains ist gegenläufig zu der der Opiate. Ähnliches gilt für Amphetamine. Kokablätter sind ein Stärkungsmittel südamerikanischer Indios. Der Wirkstoff setzt Kraftreserven frei, damit man den Aufstieg ins Hochland der Anden schafft.
Dem entspricht die Wirkung des Kokains. Plötzlich hat man neue Kraft. Dem Aufstieg ins Hochland entspricht ein Anstieg des Vitalitätsgefühls. Ungeachtet der lästigen Tatsache, dass man einer leiblichen Existenz angehört, die dem Willen, selbst über sich zu bestimmen, Grenzen setzt, spürt man neuen Tatendrang. Man fühlt sich hochpotent und glaubt, man könne sich alles aus eigener Kraft beschaffen. Kokain ist ein Turbolader. Es katapultiert den Süchtigen in einen Zustand befreiter Autonomie. Dort braucht er nichts und niemanden, um großartig zu sein.
Die Beschaffung des wenigen an Zugehörigkeit, das der Berauschte noch braucht, glaubt er voll im Griff zu haben. Ohne die Angst, dass er durch Zurückweisung ernsthaft zu verletzen wäre, geht er ungehemmt auf andere zu. Bekommt er in der Disco von der ersten Braut einen Korb verpasst, spricht er eben die nächste an. So wichtig ist die Person des anderen ja nicht, wenn man ihn bloß noch als Mittel für eigene Zwecke braucht!
Lässt die stimulierende Wirkung nach, kommt dem Kokainkonsumenten die Erlebnisfähigkeit seiner nüchternen Existenz erbärmlich vor. Von Selbstwertzweifeln bedrängt, droht er aus der eben noch erlebten Handlungsmacht in Depression zu verfallen. Es sei denn, der Stoff ist noch nicht alle...
Tranquilizer dämpfen die Wachsamkeit. Sie machen aus Stieren Lämmer. Sie melden der Psyche, dass alles in Ordnung ist. Nichts Drängendes steht zur Erledigung an. So hemmen Tranquilizer autonome Impulse. Ist der Impuls, im eigenen Interesse zu handeln abgeschwächt, nimmt man leichter hin, was vorliegt. Weder der Ärger über die anderen kommt auf, noch die Angst vor der eigenen Aggression. So braucht man nicht mehr zu fürchten, dass man beim Kampf gegen missliche Zustände mit dem Umfeld ernsthaft aneinandergerät. Der Konflikt zwischen dem Wunsch nach Zugehörigkeit und dem nach Selbstbestimmung lässt nach... und damit die Angst, die durch diesen Konflikt entsteht.
Cannabis intensiviert die Wahrnehmung. Das betrifft sowohl das sinnlich Erlebbare als auch die assoziative Fülle der eigenen Phantasie. Dadurch lenkt es die Aufmerksamkeit auf die Reichhaltigkeit des Hier-und-Jetzt und steigert das Gefühl der Zugehörigkeit des Konsumenten zu seiner unmittelbaren Gegenwart. Indem Cannabis das Interesse auf das fokussiert, was in der Nähe des Subjekts liegt und von diesem sowohl erlebt als auch beeinflusst werden kann, blendet es Aspekte aus, die das Ich aus der Ferne bedrohen. Die Angst vor anonymer Verlorenheit in der unpersönlichen Weite des Daseins wird schwächer.
Da Cannabis es dem Konsumenten erleichtert, das als Reichtum zu empfinden, was auch ohne Kampf gegeben ist, schwächt es Impulse zum autonomen Handeln ab. Da autonomes Handeln zu Rivalitäten mit dem Umfeld führt und zur Gefahr, soziale Zugehörigkeiten einzubüßen, mindert es daraus resultierende Ängste.
Dementsprechend führt dauerhafter Cannabiskonsum häufig zu einem sogenannten demotivationalen Syndrom. Salopp gesagt: Der Dauerkiffer ist nicht gerade der, der Probleme um ihn herum als erster erkennt und tatkräftig zupackt.
Demotivational heißt: Es fehlt an der Motivation zum Handeln. Beweggründe, gesellschaftlich positionierende Ziele und sozialen Aufstieg anzustreben, verlieren an Kraft. Das kann Fort- oder Rückschritt sein.
Schaden droht dem Konsumenten aber nicht nur durch den Konsum, sondern auch durch eine Politik, die den Konsum kriminalisiert und dadurch vielen Konsumenten mehr Schaden zufügt, als der Suchtstoff selbst. Da Konsum zwar dem Konsumenten schaden kann, nicht aber Dritten, ist die Kriminalisierung des Konsums ein Verstoß gegen legitime Freiheitsrechte.
Tatsächlich ist die eigenverantwortliche Anwendung von Produkten der Natur, sofern sie keinem anderen unmittelbar schadet, ein primäres Menschenrecht. Es wurde jedem Einzelnen von der Schöpfung mit auf den Weg gegeben. Es zu verbieten ist Machtmissbrauch. Das Verbot ist eine Bevormundung aufgrund fehlendem Sachverstand, der nicht nur dem Kriminalisierten schadet, sondern auch der Gesellschaft als Ganzes.
Polarisierung und Infantilisierung
Die Spaltung der Gesellschaft in die, die verbieten und jene, denen verboten wird, hat psychosoziale Konsequenzen. Das asymmetrische Beziehungsverhältnis, das ein Verbot festsetzt, droht den Bevormundeten auf infantile Muster zu fixieren. Das Verbot spricht ihm Recht und Fähigkeit ab, eigenverantwortlich für sich zu entscheiden. Indem es ihn der Verantwortung beraubt, drängt es den Beraubten in kindliche Sicht- und Verhaltensweisen hinein: entweder in die Rolle eines braven Kindes oder in die eines trotzigen. Weder brave noch trotzige Erwachsene sind für die Gesellschaft ein Gewinn.
Der Suchtbegriff kann auf Verhaltensmuster angewandt werden, bei denen keine Substanz konsumiert wird. Die Dynamik solcher Muster zeigt Parallelen zu dem, was beim Konsum suchterzeugender Substanzen vor sich geht. Zugleich gibt es aber Unterschiede: So fällt bei Süchten, die an keinen Suchtstoff gebunden sind, die spezifische Substanzwirkung auf das Zentralnervensystem weg. Es kommt zu keinen Bewusstseinsveränderungen, die durch Stimulation oder Blockade spezifischer Rezeptoren im Gehirn hervorgerufen werden.
Bei der Glücksspielsucht mag die Hoffnung, vom Schicksal zum Glückspilz befördert zu werden, zunächst treibendes Motiv sein. Neben dem materiellen Vorteil, den ein Gewinn brächte, wäre auch der emotionale beträchtlich. Glücksgöttin Fortuna hätte eine Wahl getroffen, die nicht nur durch den Gewinn autonomes Handeln erleichtert, sondern die den Spieler aus der Anonymität seiner Bedeutungslosigkeit in die Zugehörigkeit derer hebt, die von höheren Mächten begünstigt werden.
Mit wachsenden Verlusten wird das Motiv stärker, das Schicksal zur Umkehr zu zwingen. Der Spieler will nicht akzeptieren, dass ihm das Schicksal statt der erhofften Erhöhung eine Demütigung zuweist.
Gefährden die Verluste die Zugehörigkeit zu Gemeinschaften jenseits des Spielsalons, wird der Impuls stärker, sich vor der drohenden Ausgrenzung in die Spielwelt zu flüchten. Obwohl er nicht mehr wirklich glaubt, dass er gewinnen kann, kauft sich der Spieler ein paar Stunden Geborgenheit in einer Welt aus schützenden Schatten und wärmendem Licht. Koste es, was es wolle!
Kriterien der Glücksspielsucht
in Anlehnung an DSM-VI
Beim Glücksspiel kommt es zu einer Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das Spielgeschehen. Analog zur Wirkung des Alkohols werden dadurch Bewusstseinsinhalte ausgeblendet, die mit Kränkungen oder Sorgen verknüpft sind. Der Spieler kann "endlich abschalten". Für die Dauer des Spiels ist er von der Welt da draußen befreit.
Ebenfalls analog zum Alkohol kommt es zum Kontrollverlust. Solange sich der Spieler aufs Spiel konzentriert, bleiben die Sorgen auf Abstand. Je länger er spielt, desto mehr verliert er jedoch. Also hat er wachsenden Grund zur Sorge und spielt weiter, um gar nicht erst daran zu denken. So kommt der Teufelskreis in Gang.
Im Grundsatz hofft der Spieler auf Gewinn, der ihn womöglich von allen Sorgen befreit und ihm beweist, dass er dem Schicksal etwas wert ist. Weil er sein Spiel jedoch als Schuld erlebt, nimmt er den Verlust als Buße dafür hin.
Freiheit, Trotz und Willkür
Es gibt zwei Arten des Glückspiels:
Die erste Art, zum Beispiel Poker, basiert auf einer Mischung von Glück und Können. Der Pokerspieler ist nicht auf den reinen Zufall angewiesen. Er schätzt Wahrscheinlichkeiten ein, deutet Mimik und Verwegenheit des Gegners.
Die zweite Art besteht aus reinen Willkürakten. Beim Roulette entscheidet der Spieler über den Zeitpunkt des Einsatzes. Inhaltlichen Hinweisen, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, folgt er nicht; da es keine gibt.
Das Muster des zweiten Spielers kann man verschieden deuten:
Vielleicht gibt es Spieler, für die die willkürliche Wahl ein trotziger Akt der Befreiung ist. Indem sie das Willkürliche tun, entziehen sie sich der Unterordnung unter sämtliche Regeln der Folgerichtigkeit; also Regeln, denen sie im Alltag auf Schritt und Tritt unterworfen sind. Lieber als stets der Vernunft zu gehorchen, nehmen Sie den Verlust aller materiellen Werte in Kauf. Kamikaze für die Selbstbestimmung!
Computerspiele bieten virtuelle Wirklichkeiten, in denen der Spieler ein bergendes Zuhause findet. Er schlüpft in die Rolle eines Helden, der mit geringen Mitteln große Erfolge feiert. Über kurz oder lang werden alle Feinde besiegt. Alle Widrigkeiten werden überwunden. Nach jedem Tod erfolgt die Auferstehung. Jeder Sprung auf den nächsten Level hebt den Spieler hinauf zum Olymp. Dort wird er unangreifbar sein, bewundert, geehrt und respektiert.
Kriterien der Computerspielsucht
in Anlehnung an DSM-V
Süchtig wird das Spiel, sobald Bezüge zur realen Welt in Vergessenheit geraten. Der Spieler kümmert sich nicht mehr um seinen Freundeskreis. Für Hausaufgaben, Studium und Beruf bleibt kaum noch Zeit, weil er den Anschluss an die Gilde in der Cyberwelt nicht verpassen will. Mit dem Umfeld gerät er in Konflikt, weil er sich dem Spielerfolg zuliebe kaum noch um das Umfeld kümmert.
Der Kreislauf der Sucht beginnt, wenn das Spiel die Position des Spielers in der realen Welt verschlechtert, sodass ihn die Flucht ins Spiel immer mehr verlockt. Warum sollte man sich um die banalen Probleme der Außenwelt kümmern, wenn es drinnen erregend, bestätigend und behaglich ist?
Bei der Magersucht (Anorexie) und der Ess-Brechsucht (Bulimie) spielen komplexe Motive eine Rolle, die sich meist um die Ablösung aus dem Elternhaus ranken.
Je mehr sekundäre Probleme Essstörungen erzeugen, desto stärker wird das Motiv, die Angst vor der Selbstbehauptung im Leben durch eine Verengung des Bewusstseins auf das richtige Körpergewicht auszublenden. Daher haben auch Essstörungen durch Kontrollverlust und Selbstverstärkung süchtigen Charakter.
Shopping
Ich kaufe nicht, wovon ich weiß, dass ich es brauche. Ich kaufe, weil mich etwas zum Kaufen anregt.
Der Kaufsüchtige wird vom Drang beherrscht, unliebsame Stimmungen durch den Kauf von Gegenständen zu verdrängen. Womöglich ist es schiere Langeweile. Der Erwerb von Sachwerten verschafft ihm ein wohltuendes Gefühl, weil die äußerliche Bereicherung die vermeintliche Armut der eigenen Existenz übertönt. Gefördert wird die Kaufsucht durch ein gesellschaftliches Klima, das Konsum und Besitz von Waren einseitig als Zeichen des Erfolgs verkündet.
Da der Kaufsüchtige sich selbst nur wenig gilt, schenkt er sich selbst nur wenig Beachtung. Das führt zu zweierlei:
Als Folge davon hält die Dämpfung des Selbstwertzweifels nach einem Kauf nur kurze Zeit und er kauft Sachen, die er eigentlich kaum gebrauchen kann.
Indem er die Torheit seiner Käufe immer wieder aufs Neue erlebt, untergräbt er sein Selbstwertgefühl durch jenes Tun, durch das er es zu heben versucht. Auch hier wird die Grundregel der Sucht erkennbar.
Der Begriff Workaholic hat die Tatsache ins Bewusstsein gerückt, dass auch Arbeit als Suchtmittel dienen kann. Das Motiv, sich exzessiv in Arbeit zu stürzen, ist das gleiche, wie bei anderen Süchten: Es dient dem Versuch, unliebsame oder schmerzhafte Gefühle, Erkenntnisse und Wirklichkeiten zu verdrängen.
Die typischen Merkmale der Sucht - Dosissteigerung, Kontrollverlust, Entzugserscheinungen und Toleranzentwicklung - markieren auch die Arbeitssucht.
Als Folgeerkrankung der Arbeitssucht kann es zu einem Burn-out-Syndrom kommen. Der hohe Energieverbrauch, den die Verdrängung gefürchteter Bewusstseinsinhalte durch die einseitige Bündelung der Achtsamkeit auf berufliche Aufgaben mit sich bringt, führt zu einem energetischen Ausbrennen. Dessen Kernsymptome sind...
Sobald die Arbeitswut wegen Energiemangels nicht mehr aufrechterhalten werden kann, drängen hinter der Problematik des Burn-out-Syndroms die ungelösten seelischen Konflikte hervor, die durch den arbeitssüchtigen Abwehrmechanismus bis dahin ausgeblendet wurden. Resultat sind oft schwere depressive Krisen.
Obwohl die arbeitssüchtige Fehlentwicklung als Gefährdung der seelischen Gesundheit erkannt ist, gibt es in der Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) keine entsprechende Kategorie. Vielleicht hängt das mit einem Zeitgeist zusammen, der die Maximierung des wirtschaftlichen Erfolgs als zentrale gesellschaftliche Zielsetzung sieht.
Denksucht
Zu den unliebsamen Gefühlen, die der Arbeitssüchtige bekämpft, kann das Gefühl der Unterlegenheit gehören. Logisch: Arbeit zielt auf Erfolge ab, die nicht nur die Grundbedürfnisse des Lebens erfüllen, sondern auch die Position im sozialen Umfeld verbessern. Der Fleißige steht über kurz oder lang meist besser da als der, der die Dinge erst einmal aufschiebt.
Liegt es da nicht auf der Hand, auch von einer Denksucht zu sprechen. Das Phänomen kennen viele. Wie oft passiert es einem selbst, dass man nicht mit dem Denken aufhören kann? Und wie oft hört man von anderen, dass es ihnen ähnlich ergeht? Was ist Denken? Gedanken sind Überlegungen, die man anstellt. Und was regt das Denken besonders an? Wenn es einem schlecht geht. Dann denkt man über Lösungen nach, zuweilen so unaufhaltsam, dass man von einem Kontrollverlust sprechen kann. Der Denksüchtige kann seine Überlegungen nicht unterlassen, weil er sich partout überlegen fühlen will.
Eine Lösung kann im Eingeständnis liegen: Ich komme mir unterlegen vor. Dass ich mich so fühle, nehme ich erst einmal hin.