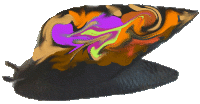
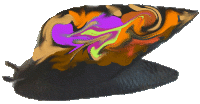
Manche Patienten erwarten, durch suchttherapeutische Maßnahmen geheilt zu werden. Dabei ist der eigene Anteil, der zum Erfolg beizutragen ist, nirgends größer als bei der Überwindung einer Sucht. Der Süchtige wird nicht geheilt. Er lässt die Sucht hinter sich.
Eine Suchttherapie besteht aus fünf Phasen:
Information / Motivation
Informationen zeigen die Suchtdynamik, die Suchtgefahren und die Bewältigungsmöglichkeiten der Erkrankung auf. Motivation ermutigt den Patienten, die Hürden zur Bewältigung der Abhängigkeit anzugehen.
Entgiftung
Die Entgiftung beendet die Substanzwirkung auf den Körper. Dadurch findet der Organismus in das natürliche Gleichgewicht seiner spontanen Stoffwechselprozesse zurück.
Entwöhnung
Die Entwöhnung verändert langfristige Verhaltensmuster. Die Gewohnheit, das Bewusstsein durch betäubende oder erregende Substanzen zu verändern, wird durch die Gewohnheit ersetzt, der Wirklichkeit mit klarem Verstand zu begegnen.
Nachsorge
Die professionelle Nachsorge hilft bei der Beibehaltung der gesteckten Ziele.
Selbsthilfe
Selbsthilfe sichert den Erfolg über die Phase der professionellen Nachsorge hinaus.
Keine der fünf Phasen ist zwingend erforderlich. So mancher Suchtkranke ist gut informiert, viele so entschlossen, dass keine Motivation vonnöten ist. Einige schaffen es, ohne Entgiftung den Konsum auf unbedenkliche Maße zu drosseln. Viele bleiben nach dem Entzug auch ohne Entwöhnung und Nachsorge abstinent. Selbsthilfegruppen sind keineswegs für alle attraktiv.
Nehmen Suchtkranke erstmals Kontakt zum Suchthilfesystem auf, fehlen ihnen oft wichtige Informationen. Drei Themen stehen im Vordergrund:
Sind die Informationen vermittelt, ist der Grundstein zum Ausstieg aus der Sucht gelegt. Oft sind Patienten jedoch zwiespältig. Oft sind ihrem Vorsatz Zweifel beigemengt...
Dann ist Motivation vonnöten. Es gilt dem Zweifler Mut zu machen und jene Partei in seinem Inneren zu unterstützen, die auf der Seite der Gesundheit steht.
Was bei der Information gilt, gilt nicht bei der Motivation. Bei der Motivation gilt: gerade mal so viel, wie sinnvoll. Und das ist eher wenig.
Viele mag das überraschen. Wer die Psychodynamik des Menschen versteht, den überrascht es nicht. Motivation ist die zielgerichtete Beeinflussung des Verhaltens eines anderen Menschen. Da der Mensch ein Bedürfnis nach Selbstbestimmung hat, ist Motivation ein Eingriff in dessen höchstpersönliche Entscheidungsbefugnis. Jemanden zu bedrängen, sich anderes zu verhalten, als er es tut, wird schnell zu einem Übergriff, der mehr Schaden anrichtet, als er nützt. Die ständige Ermahnung von außen, dies oder das zu tun, ruft automatisch Widerstände beim Ermahnten hervor, die keineswegs dazu beitragen, den richtigen Weg zu gehen.
Ein guter Rat von gleich zu gleich ist unverfänglich. Ein guter Rat ist Kommunikation. Ermahnung unterstellt jedoch ein hierarchisches Bezugsverhältnis. Ermahnt wird von oben nach unten. Ermahnung ist ein Werkzeug der Erziehung. Durch hartnäckige Motivation wird die Ebenbürtigkeit der Beteiligten in Frage gestellt. Sie kann daher das Selbstwertgefühl des Ermahnten untergraben und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass er sein sowieso schon brüchiges Selbstwertgefühl durch Trotz zu stabilisieren versucht.
Je nach Substanz und Intensität des Konsums sind unterschiedliche Entzugserscheinungen zu erwarten. Bei manchen Substanzen können die körperlichen Entzugserscheinungen gefährlich sein... und sogar tödlich enden. Bei anderen sind die körperlichen Entzugserscheinungen schwach. Dann besteht das Problem der Entgiftung darin, den psychischen Symptomen standzuhalten.
Schwerpunkt der Entzugserscheinungen
| Substanz | körperlich | psychisch |
| Alkohol | +++ | +++ |
| Tranquilizer | + | ++ |
| Opiate | ++ | ++ |
| Kokain Amphetamine |
- | +++ |
| Cannabis | (+) | ++ |
Die notwendigen medizinischen Maßnahmen und Rahmenbedingungen des Entzugs hängen von der Gefährlichkeit möglicher Entzugserscheinungen ab. Oft entscheidet sich der Süchtige, auf eigene Faust zu entgiften; oder er hat kein Geld mehr, um sich das Suchtmittel zu beschaffen; sodass er von den Umständen zwangsentgiftet wird.
Besonders Personen, deren Gesundheitszustand problematisch ist, sollten vor einer Entgiftung ihren Arzt befragen. Bei schwerer Alkoholabhängigkeit und bekannten Entzugskomplikationen ist eine stationäre Entgiftung zu empfehlen.
Die Entgiftung bei Alkoholabhängigkeit erfolgt ambulant oder stationär.
Eine ambulante Entgiftung ist nur Patienten zu empfehlen, die keine weiteren gesundheitlichen Risikofaktoren aufweisen, bei denen keine schwerwiegenden Entzugserscheinungen bekannt sind und deren Entzug durch eine verantwortungsvolle Bezugsperson begleitet wird.
Ambulante Entgiftung
Fragen im Vorfeld
Auch beim ambulanten Entzug wird der Alkohol oft auf einen Schlag abgesetzt. Sinnvoll ist, den Konsum im Vorfeld bereits schrittweise zu reduzieren. Sobald der Alkoholspiegel hinreichend gesunken ist, werden aufkommende Entzugserscheinungen in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt medikamentös behandelt. Treten Komplikationen auf, ist die sofortige Einweisung in eine Fachklinik notwendig.
Sind die Bedingungen für eine ambulante Entgiftung nicht erfüllt, sollte man stationär entgiften. Die stationäre Entgiftung hat den Vorteil, dass beim Auftreten gefährlicher Entzugserscheinungen sofort gehandelt werden kann.
Risikofaktoren, die eine stationäre Entgiftung nahelegen
Symptome des Delirs
Zur Behandlung der Entzugserscheinungen steht eine Reihe von Medikamenten zur Verfügung: Clomethiazol, Diazepam, Carbamazepin, Tiapridal, Haloperidol. Solche Medikamente sollten nur nach ärztlicher Verordnung eingenommen werden. Nach Abschluss der Entgiftung beginnt die Entwöhnung.
Während ein Alkoholentzug in der Regel nach einer Woche überstanden ist, streckt sich der Entzug von Tranquilizern oft über viele Wochen hin. Besonders, wenn hohe Dosen über lange Zeit konsumiert wurden, können bei raschem Entzug gefährliche Symptome auftreten: Krampfanfälle und Entzugspsychosen. Daher ist ein sogenannter fraktionierter Entzug, also ein Ausschleichen der Substanz zu empfehlen.
Ob ambulant oder stationär zu entgiften ist, entscheidet der gesundheitliche Gesamtzustand. Da sich manche Entzugserscheinungen (Ängste, Nervosität, Anspannung, Schlafstörungen) hinziehen, braucht der Patient einen langen Atem. Entgiftet wird durch die schrittweise Reduktion der Dosis. Das Tempo der Reduktion sollte man individuell an die eigenen Möglichkeiten anpassen. Wegen der Dauer der Entzugserscheinungen geht die Entgiftung fließend in die Entwöhnung über.
Orientierendes Schema zur Entgiftung von Benzodiazepinen
Bei sehr hohen Konsummengen ist eine stationäre Entgiftung anzuraten, da die Erfolgsaussichten dann deutlich besser sind.
Beim kalten Entzug wird das Opiat schlagartig abgesetzt. Aufkommende Entzugserscheinungen werden allenfalls durch Medikamente abgefedert, die selbst nicht zur Gruppe der Opiate gehören. Zum Einsatz kommen Tranquilizer und dämpfende Antidepressiva (z.B. Doxepin, Amitriptylin). Vorteil des kalten Entzugs ist die relativ kurze Dauer. Sein Nachteil ist die Wucht der Entzugserscheinungen, die so manchen Süchtigen dazu antreibt, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um an den begehrten Stoff zu kommen; was ihm dann auch oft gelingt, denn der Erfindungsreichtum vieler Opiatsüchtiger ist beachtlich.
Beim sogenannten warmen Entzug wird das missbrauchte Opiat (in der Regel Heroin) durch ein synthetisches Opiat ersetzt (in der Regel Methadon), welches in der Folge schrittweise reduziert wird. Vorteil des warmen Entzugs ist die geringere Ausprägung der akuten Symptome. Sein Nachteil ist die lange Dauer... und der zuweilen zähe Verlauf.
Kokain und Amphetamine können schlagartig abgesetzt werden. Schwerwiegende körperliche Entzugserscheinungen sind kaum zu erwarten. Problematisch ist die psychische Komponente. Beim Absetzen der Stimulanzien kommt es zu depressiven Verstimmungen. Das gestörte Selbstwertgefühl und der Jammer einer ungeliebten Existenz treten überschießend zutage. So mancher hat sich aus Verzweiflung darüber umgebracht. Medikamentös ist vor allem an Tranquilizer zu denken.
Körperlich gesehen ist der Entzug von Cannabis unproblematisch. Dementsprechend sieht das Gesundheitswesen stationäre Entgiftungen kaum vor. Ob der Süchtige die Ausdauer hat, die psychischen Folgen des Entzugs durchzuhalten, hängt von seiner Motivation ab. Nur wenn ihm die Befreiung von der Droge wichtig ist, wird er sich den Stimmungsschwankungen, der Unzufriedenheit und den Schlafstörungen stellen, die beim Absetzen oft zutage treten. Lang anhaltende Schlafstörungen lösen häufig Rückfälle aus.
Defizite in Sachen Rationalität
Der Übergang zwischen unproblematischem Konsum und psychischer Abhängigkeit ist beim Cannabis genauso fließend wie beim Alkohol. Wie Alkohol kann Cannabis als akzeptabler Bestandteil einer selbstbestimmten Lebensweise betrachtet werden. Die Kriminalisierung des Konsums erschwert vielen Konsumenten eine rationale Einschätzung der Nachteile ihrer Substanz, weil die Rationalität des Verbots seinerseits fragwürdig ist.
Auch die Tatsache, dass der Entzug so schwer nicht ist, kann dem Süchtigen als Argument dazu dienen, ihn zu vertagen: Jetzt habe ich schon drei Tage nicht gekifft, ohne dass es besonders schwergefallen wäre... Falls es einmal zwingend notwendig werden sollte, vom Suchtmittel abzulassen, erledige ich das mit links. Vorerst besteht aber kein dringender Bedarf. Also kiffe ich erst einmal weiter.
Nach der Entgiftung fängt die eigentliche Bewältigung der Sucht erst an. Der Erfolg jeder Therapie besteht darin, einen Rückfall in problematisches Konsumverhalten auf Dauer zu verhindern. Nach der Entgiftung befindet sich der Süchtige in einer psychosozialen Situation, die ihm durch den langen Missbrauch seiner Substanz fremd geworden ist. Er begegnet sich selbst und der Welt mit ungetrübtem Blick. Oft wird ihn das erschrecken. Rückfälle sind häufig. Es gilt, rasch darauf zu reagieren. Die Umstände der Rückfälle können zu einem vertieften Verständnis der individuellen Suchtdynamik hinterfragt werden.
Ist der Süchtige stark rückfallgefährdet, ist an eine stationäre Entwöhnung in einer Fachklinik zu denken. Ein geeignetes Angebot dazu besteht für Abhängige von Alkohol, Tranquilizern und harten Drogen.
Egal ob stationär oder ambulant, jede Entwöhnung besteht aus zwei Teilen:
Soziale Entwöhnung
Als Mittel dazu dienen die Methoden und Einrichtungen der Sozialtherapie.
Psychologische Entwöhnung
Als Mittel dazu dienen die verschiedenen Methoden der Psycho- und Verhaltenstherapie.
Sind die ersten drei Phasen der Suchtbehandlung überstanden, ist das Kind noch nicht in trockenen Tüchern. Nach der Entlassung aus der Entwöhnungsklinik lauern Belastungen und Versuchungen. In der Klinik war der Kranke etlichen Anforderungen des Lebens enthoben. Außerdem gab die Gemeinschaft Geborgenheit und der Gruppendruck des gemeinsamen Ziels nahm so mancher Versuchung den Wind aus den Segeln. Draußen ist vieles anders. Drinnen ist Schutzgebiet, draußen freie Wildbahn.
Sozialtherapie
An dieser Stelle setzt die Nachsorge ein. Meist fußt sie auf der Anbindung an eine Suchtambulanz. Dort werden allfällige Probleme des Alltags besprochen, die eine Rückfallgefahr mit sich bringen. Oder aber, es wird eine ambulante Psychotherapie angeschlossen um Persönlichkeitsprobleme anzugehen, die die gleiche Gefahr in sich bergen.
Während die Nachsorge zumeist zeitlich begrenzt ist, ist Selbsthilfe auf Dauer ausgelegt. Ihre Bedeutung kann kaum überschätzt werden. Selbsthilfegruppen bieten Suchtkranken Zugehörigkeit und bilden eine Plattform wechselseitigen Beistands.
Viele Menschen tun sich schwer, den Platz in einer Gruppe zu finden, der ihr Gedeihen fördert. Manchmal gilt es, durchzuhalten und um den passenden Platz zu kämpfen. Ein anderes Mal ist es besser, die Gruppe zu wechseln; denn: Nicht jede Gruppe bietet für jeden den passenden Platz.
Rückfall ist ein Schlüsselbegriff der Suchttherapie. Rückfälle sind eher Regel als Ausnahme. Sie zählen zu den Angstmotiven des Suchtkranken. Rückfälle sind Scheitern und Chance zugleich.
Sie sind Scheitern, weil das Abstinenzziel für die meisten Suchtkranken ein pragmatischeres Ziel als kontrollierter Konsum ist. Abstinenz ist eine klare Linie. In der Regel ist es leichter, eine klare Linie einzuhalten, als täglich mit sich zu verhandeln, welche Menge Suchtstoff vertretbar ist. Die meisten, die sich aufs Verhandeln einlassen, zieht der Gegner über den Tisch.
Rückfälle sind Chance, weil die Auslöser der Rückfälle wichtige Hinweise darauf geben, welche Erfahrungen der Suchtkranke durch den Konsum zu vermeiden versucht. Typischerweise sind das Erfahrungen, die um folgende Themen kreisen:
Ist das Vermiedene erkannt, ist es leichter, sich ihm zu stellen. Stellt man sich bislang Vermiedenem, stellt man fest, dass man ihm durchaus standhalten kann. Daher bietet die Aufarbeitung von Rückfällen Gelegenheit, dem Therapieziel näher zu kommen.
Neben Leichtsinn ist Suchtdruck als wesentliche Ursache von Rückfällen zu nennen.
Beim Leichtsinn handelt es sich um eine Fehleinschätzung der eigenen Fähigkeit, Suchtmittel kontrolliert zu konsumieren. Leichtsinn als Ursache von Rückfällen ist vor allem anfangs häufig. Dass seine Bedeutung im Laufe der Zeit nachlässt, ist logisch. Je öfter der Kranke einen Kontrollverlust erlebt und wieder im Sumpf seines süchtigen Daseins versinkt, desto weniger kann er glauben, dass es beim nächsten Rückfall anders sein wird.
Während Leichtsinn an Bedeutung verliert, tritt Suchtdruck bei vielen in den Vordergrund. Suchtdruck ist ein umgangssprachlicher Begriff. Im Fachjargon spricht man von Substanzverlangen oder Craving (englisch to crave = begehren, verlangen, nach etwas lechzen).
Als Suchtdruck erlebt der Süchtige eine unangenehme Gefühlsqualität, von der er weiß, dass sie durch Konsum kurzfristig zu beseitigen ist. Das Gefühl selbst ist ein Resultat verschiedener Ursachen, die individuell in unterschiedlicher Mischung wirksam werden:Bei erst kurzfristig bestehender Abstinenz, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Entzugserscheinungen im Vordergrund stehen. Vor allem bei Benzodiazepinen können sie über Wochen oder gar Monate anhalten.
Besser als von Suchtdruck zu sprechen, wäre es für den Süchtigen, wenn er denkt: Ich würde am liebsten weglaufen. Ich will nicht wahrhaben, was ich tatsächlich erlebe. Ich bin versucht, meinen Gefühlen auszuweichen. Dann kann er sich als ein Täter erleben, der wählen kann. Auf lange Sicht ist das besser für sein Selbstwertgefühl.
Hat man den Entzug überstanden, drängen oft genau jene Gefühle heran, die man seit je her durch das Suchtmittel verdrängen wollte. Mit ihnen taucht das Substanzverlangen auf, das den Gepeinigten in die Arme des Suchtmittels treibt. Von großer Bedeutung bei der Entstehung des Suchtdrucks ist blanke Unentschlossenheit.
Weiß der Süchtige nicht so genau, ob er tatsächlich aufhören will oder nicht, entsteht in ihm ein Zwiespalt. Das Ringen zweier Strebungen - sich rasch durch Konsum zu entlasten oder ein abstinentes Leben zu führen - erzeugt, solange darum gerungen wird, ein Gefühl der Ungewissheit; das durch befreienden Konsum, also das Ende des Ringens, schlagartig beseitigt werden kann.
Abhängigkeit → Information / Motivation → Entgiftung → Entwöhnung → Nachsorge → dauerhafte Abstinenz: So lautet das Grundmuster einer erfolgreichen Suchttherapie. Das Leben ist aber vielschichtig und jeder Lebenslauf ein besonderer Fall. Deshalb gibt es Varianten. Viele davon enden im Abgrund. Andere führen tatsächlich zu einem kontrollierten Umgang mit Suchtmitteln, der dauerhaft stabil bleiben kann; auch dann, wenn die Kontrolle streckenweise entglitten war.
Der sogenannte kontrollierte Konsum ist das Wunschziel vieler Konsumenten. Doch Hand aufs Herz: Beim Versuch, dieses Ziel zu erreichen, sind vermutlich mehr unter die Räder als in den Sattel gekommen.
Rückkehr zum kontrollierten Konsum
| Eher wahrscheinlich | Eher unwahrscheinlich |
|
|
Grundprinzip
Klammern Sie sich nicht an die Hoffnung, kontrolliert konsumieren zu können. Gestehen Sie sich Ihr Unvermögen ein, sobald Sie mehrfach beim Versuch gescheitert sind. Es ist leichter zu sagen, Ich kann's eben nicht als Ich muss das unbedingt können. Kontrollierter Konsum ist in Ordnung. Er ist aber keine Bedingung für ein zufriedenes Leben. Die Bedingung für ein zufriedenes Leben ist die Wertschätzung des eigenen Daseins.
Die Vorsilbe ent- taucht bei der Suchttherapie häufig auf. Es wird entzogen, entgiftet und entwöhnt. Da kann der Eindruck entstehen, als gehe es in der Suchttherapie vor allem um Verzicht. Als genau das deuten sie viele Süchtige. Sie schrecken davor zurück. Sie fürchten, durch den Verzicht auf das Suchtmittel etwas zu verlieren und jenseits des Konsums zu einem freudlosen Dasein verurteilt zu sein. Bei manchen ist es so: bei jenen, die trotz Abstinenz zu keiner tieferen Wertschätzung ihres Lebens gelangen.
So wie der Selbstwertzweifel die entscheidende Weiche ins süchtige Verhalten stellt, so ist die Wertschätzung des eigenen Lebens der entscheidende Baustein einer freudvollen Enthaltsamkeit.
Die Wertschätzung des eigenen Daseins kann auf zweierlei beruhen:
Der erste faktische Erfolg, den ein Süchtiger durch die Abstinenz für sich verbuchen kann, ist die Abstinenz. Der Stolz darauf, es bereits so und so viele Tage geschafft zu haben, das selbstschädigende Verhalten zu unterlassen, hebt das Selbstwertgefühl. Das gesteigerte Selbstwertgefühl seinerseits liefert Zuversicht und Kraft: Ich kann es weiterhin schaffen. Ich kann im Leben erfolgreich sein.
Da Abstinenz die Fähigkeit steigert, Alltagsprobleme zu meistern, Unerledigtes abzuhaken und Ziele anzusteuern, die langfristig Vorteile versprechen und die gesellschaftliche Position verbessern, ist mit großer Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass eine erfolgreiche Abstinenz auch zu weiteren faktischen Erfolgen über sich selbst hinausführen wird. Der Weg dorthin ist aber oft steiniger als erhofft, sodass so mancher die Flinte ins Korn wirft, sobald Erfolge auf sich warten lassen; dann nämlich, wenn seine Sucht nach dem Stoff zu einer Sucht nach äußeren Erfolgen geworden ist und diese nicht zeitnah befriedigt wird.
Da es immerhin möglich ist, Frustrationen zu ertragen, gelingt es vielen, den Anfangserfolg der Abstinenz zum Ausgangspunkt weiterer Erfolge zu machen und so ihr Selbstwertgefühl soweit zu stabilisieren, dass sie die üblichen Misserfolge und Enttäuschungen, die auch die Geduld eines abstinenten Menschen auf die Probe stellen, ohne fatale Einbrüche meistern.
Eins ist aber klar: Die faktischen Erfolge persönlicher Lebensentwürfe sind auf die Außenwelt angewiesen. Und diese Außenwelt zeichnet sich durch Merkmale aus, die für immer und ewig eine Gefahr für das Selbstwertgefühl des Einzelnen darstellen werden. Die Außenwelt ist erstens permanent veränderlich und zweitens durch den Einzelnen nur zu einem geringen Teil kontrollierbar.
Fußt das Selbstwertgefühl ausschließlich auf äußerem Erfolg, steht es bloß auf einem Bein. Wenn das einmal wegknickt, weil ein Stein im Wege liegt, wo keiner liegen sollte, bricht alles zusammen. Kurzum: Ein stabiles Selbstwertgefühl braucht ein zweites Bein. Es braucht ein Bein, das durch die schwankenden Bedingungen der Außenwelt in seiner Standfestigkeit nicht beeinträchtigt werden kann. Am besten wäre sogar ein Bein, das durch widrige Bedingungen sogar gefestigt wird. Kann es so etwas geben? Es gibt es. Es ist die radikale Akzeptanz der eigenen Erfahrung.
Unser Weltbild ist gespalten. Wir unterscheiden zwischen Gut und Böse bzw. zwischen Gut und Schlecht. Nicht, dass solche Unterscheidungen sinnlos wären, im Gegenteil: Jeder Pilzkenner wird auf Unterschiede achten. Erfahrungen sind jedoch keine Gegenstände, die man objektiv nach ihrem Nutzwert klassifizieren könnte. Erfahrungen sind Formen des eigenen Erlebens und jede Form, die man bewusst durchlebt, kann im Endeffekt bereichern. Nicht umsonst gibt es den Begriff Erfahrungsschatz.
Topographische Beziehungen
| Ich und die Objekte | Ich und die Erfahrung |
| Ich bin hier. Dort sind die Objekte. | Ich bin hier. Hier ist die Erfahrung. |
Das Verhältnis zwischen dem Ich und der Erfahrung ist viel enger als das zwischen dem Ich und den erfahrenen Objekten. Das Ich ist die Erfahrung, die es macht, sein Selbst die Instanz, die davon Kenntnis nimmt. Erfahrungen nicht zu akzeptieren, heißt sich selbst nicht sehen zu wollen. Wer sich übersieht, entzieht sich Anerkennung, die er braucht.
Sich eines Erfahrungsschatzes zu erfreuen ist aber etwas anderes, als vor Erfahrungen zu stehen, die dereinst den Schatz bereichern. Zumindest für einen großen Teil der Erfahrungen trifft das zu: für die, die wir als unangenehm empfinden.
Im Regelfall nehmen wir das Wort unangenehm zu ernst. Wir meinen, unangenehme Erfahrungen sollte man gar nicht erst annehmen. Zu diesem Zweck, werten wir sie ab. Wir bezeichnen sie als schlecht oder negativ und trachten danach, sie mit allen Mitteln zu umgehen.
Erfahrungen sind aber - das ist zu betonen - keine Elemente der Außenwelt, sondern Bestandteile des eigenen Lebens. Wer Bestandteile des eigenen Erlebens zu etwas Schlechtem entwertet, entwertet sich selbst.
Die Neigung, die unangenehmen Erfahrungen, die das Leben arrangiert, durch Suchtmittel zu betäuben, abzuschwächen, zu verfälschen oder ins Gegenteil zu verdrehen, erweist sich als Teufelskreis. Zuerst wird Unangenehmes abgewertet. Sein Wert als korrigierende Erfahrung wird nicht anerkannt. Weil es nicht offenen Auges erfahren und angenommen wird, bleibt die Schatzkiste halb leer. Da Erfahrung zur Weisheit führt und Weisheit jedes Lebens als wertvoll erkennt, wird der unbedingte Selbstwert verkannt und das Gefühl des eigenen Wertes bleibt auf die ungewissen Erfolge angewiesen, über die der Wellengang der Welt mitbestimmt.
Analogien
War der Begriff Sucht früher dem pathologischen Konsum bewusstseinsverändernder Substanzen vorbehalten, wird er heute auch auf problematische Verhaltensweisen angewandt, bei denen psychotrope Substanzen keine Rolle spielen. Man denke an die Magersucht, die Spielsucht oder die Arbeitssucht. Das ist folgerichtig.
Nicht nur die oberflächlichen Merkmale des Suchtverhaltens sind bei den nicht-stoffgebundenen Süchten ähnlich, zum Beispiel der Wirkverlust und die nachfolgende Inflation des Suchtverhaltens mit begleitendem Kontrollverlust, sondern auch die psychologische Funktion, die der Sucht zugrunde liegt.
Diese Funktion ist offensichtlich: Sucht dient der Verdrängung unliebsamer Stimmungen und unerfreulicher Gefühle, vor allem solcher, die die Selbstwertregulation betreffen. Wer glaubt, sein momentanes Erleben sei Zeichen irgendeines Unwerts, kann alles Mögliche in Bewegung setzen, um das Signal des vermeintlichen Makels aus der Welt zu schaffen.
Der andere opfert Fortuna den letzten Pfennig, um von einer Göttin auserwählt zu werden, die über ihre Gunst am Würfeltisch entscheiden lässt.
Die Beispiele machen deutlich: So ziemlich alles, was der Mensch tut, kann süchtig entgleisen, sobald es dem Ziel dient, Selbstwertzweifel zu entkräften. Zuletzt entkräftet die Sucht aber nicht den Zweifel, sondern den Zweifler selbst. Passend dazu kommt Sucht nicht von suchen. Es kommt von siechen. Um das Siechtum aufzuhalten, gilt es, Selbstwertzweifel als Erfahrung hinzunehmen; in der Gewissheit, dass der Mensch seinen Wert bezweifeln, aber nicht bestimmen kann.