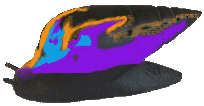
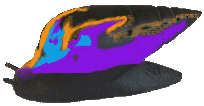
Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) wird durch traumatische Belastungen ausgelöst. Einerseits sind elementare Erschütterungen zu nennen, die Leib und Leben des Betroffenen objektiv gefährden. Andererseits kann die Symptomatik durch Erschütterungen des Selbst- und Weltbilds verursacht werden, die die soziale Einbindung des Betroffenen und damit seine soziale Existenz infrage stellen.
Realität und Definition
Die offiziellen Diagnosekriterien der PTBS sind eng. Die ICD-10 macht als Auslöser ein Ereignis mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß zur Bedingung, das bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde.Diese Definition ist fragwürdig. Sie übersieht die große Individualität seelischer Reaktionsweisen. Seelische Reaktionen folgen nicht nur faktischen Ereignissen der Außenwelt auf die fast jeder gleich reagiert. Sonst hätte kein Mensch je Angst vor einer Spinne oder könnte in Verzweiflung geraten, weil sein Partner fremdgegangen ist.
Tatsächlich ist es so, dass die Symptomatik der PTBS nicht nur durch elementare Ereignisse ausgelöst werden kann, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen, sondern auch dann, wenn ein relativ alltägliches Ereignis auf eine besondere persönliche Reaktionsbereitschaft trifft.
In der therapeutischen Praxis ist daher die tatsächliche Reaktion des Individuums zu beachten und nicht die Frage, ob die Theorie es der Symptomatik zugesteht, einem konkreten Ereignis zu folgen.
Als mögliche Auslöser der PTBS sind zu nennen:
Ein Ereignis - vier Reaktionen
Der Partner ging fremd. Für den Betrogenen kann das Verschiedenes bedeuten:
Die Häufigkeit der PTBS hängt von der Art des Traumas ab. Angaben zur Häufigkeit sind in der Literatur breit gestreut; was gewiss daran liegt, dass sowohl die Definition der Intensität eines Traumas als auch die Bewertung psychischer Symptome vom Untersucher abhängen. Man findet die PTBS in...
Generell gilt: Die Wahrscheinlichkeit einer PTBS ist größer, wenn die Bedrohung oder Schädigung durch andere Personen verursacht wurde. Sie ist geringer, wenn der Schaden durch Zufall oder Naturkräfte entstand.
Die Symptome der PTBS treten entweder kurz nach dem Trauma oder mit einer Latenz von Wochen bis Monaten auf. Unter Umständen können zwischen dem Trauma und der Symptomatik Jahre vergehen. Symptome, die innerhalb der ersten Tage nach dem Trauma auftreten, werden als Akute Belastungsreaktion bezeichnet. Die PTBS geht nahtlos aus der Akuten Belastungsreaktion hervor oder sie folgt nach einer symptomfreien Periode. Sie kann aber auch ohne vorherige Belastungsreaktion auftreten.
Symptome der PTBS
Grundsätzlich wird die PTBS durch den traumatisierenden Faktor ausgelöst, der die Psyche des Betroffenen von außen erreicht und zu einer nachhaltigen Erschütterung seines Welt- und Selbstbilds führt. Es ist jedoch bekannt, dass keineswegs alle Opfer erschütternder Erfahrungen eine PTBS entwickeln. Offensichtlich gibt es Persönlichkeitsmerkmale, die das Auftreten der PTBS begünstigen, indem sie problemträchtige Interaktionsmuster mit dem Umfeld bahnen, die die Verarbeitung von Traumata erschweren.
Das Kernproblem bei der Posttraumatischen Belastungsstörung liegt im Versuch...
Vom Verstand her wissen wir, dass unser Platz in der Welt bedroht ist. Wir wissen, dass wir zerbrechliche Wesen sind, deren Wohlergehen größtenteils in den Händen eines übermächtigen Schicksals liegt. Um die Angst vor Tod und Verderben, vor Ohnmacht und Ausgeliefertsein zu entkräften, leben wir jedoch so, als könne uns - zumindest vorerst - eigentlich nichts passieren. Um uns in Sicherheit zu wiegen, glauben wir, dass uns als Person so viel Bedeutung zukommt, dass es das Schicksal dann doch nicht wagen wird, diese Person fundamental zu missachten. Das Trauma führt uns den Irrtum mit aller Macht vor Augen.
Das Schicksal der Erfahrung
Eine Erfahrung kann...
Wird das Selbstbild infrage gestellt, gibt es drei Möglichkeiten: Die Infragestellung...
Kann eine Erfahrung, die das Selbstbild infrage stellt, weder integriert, noch verdrängt oder abgespalten werden, droht eine PTBS.
Der Glaube an unsere vermeintliche Wichtigkeit führt meist dazu, dass wir im Leben überwiegend mit den Vor- und Nachteilen für unsere eigene Person beschäftigt sind. Wir sind eifrige Vollstrecker egozentrischer Motive. Das Trauma stellt den Sinn dieses Eifers in Frage. Wenn die Bedeutungslosigkeit unserer Person offensichtlich wird, können wir eigentlich nicht weitermachen wie bisher. Das Trauma wirft uns aus der Kreisbahn um den kleinen Mittelpunkt. Der eine hat den Mut zur Weiterreise, der andere versucht, das Erlebte auszublenden; ohne dass es ihm wirklich gelingt.
Die Symptomatik spiegelt den Kampf zwischen Ausblendung und heilsamer Wahrheit wieder. Da werden alle Situationen gemieden, die an das Trauma erinnern. Da wird die Erinnerung zum Teil aus dem Gedächtnis gestrichen. Entgegen aller Bemühung schießen die erschreckenden Bilder dann aber ins Bewusstsein ein und tauchen in den Träumen wieder auf. Der Kampf erzeugt Nervosität, Anspannung und eine Hypervigilanz, also eine übermäßige Wachsamkeit, die der Angst vor der Vertreibung aus der gewohnten Kreisbahn entspricht.
Nicht jeder erleidet nach einem Trauma eine Belastungsstörung. Daraus folgt: Menschen sind unterschiedlich vulnerabel (lateinisch: vulnerare = verwunden). Wichtige Faktoren, die die Verwundbarkeit durch seelische Erschütterungen erhöhen, können akzentuierten Persönlichkeitsmustern zugeordnet werden, die die Bewältigungsmöglichkeiten der traumatisierten Person einschränken:
Zur Rolle der Bezugspersonen
Der Mensch lebt im sozialen Kontext. Daher wird nicht nur die Vulnerabilität des Betroffenen durch dessen Persönlichkeitsproblematiken erhöht, sondern der weitere Verlauf - Heilung oder Chronifizierung - hängt auch von den Persönlichkeiten wichtiger Bezugspersonen ab. Lebt der Traumatisierte in einem solidarischen Umfeld, kann er das Trauma leichter überwinden. Ist er von problematischen Bezugspersonen umgeben, fällt es ihm schwerer.
Das Gegenteil von Vulnerabilität ist Resilienz (lateinisch: resilire = abprallen, zurückspringen, sich zusammenziehen, schrumpfen, verkleinern). So wie die Faktoren psychischer Vulnerabilität die Gefahr traumatischer Folgestörungen erhöhen, so wird sie durch sogenannte Resilienzfaktoren vermindert. Wichtige Resilienzfaktoren sind:
Gerät ein Wirtschaftsunternehmen ins Trudeln wird eine Gesundschrumpfung durchgeführt. Die Firma trennt sich von peripheren Geschäftsfeldern und konzentriert sich auf das Kerngeschäft. Durch die Straffung ihrer Außengrenzen wird die Firma resilient.
Jedes Trauma ist Verlust. Je mehr äußere Bedingungen das Selbstbild einbezieht, um das Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten, je weiter es sich also über den inneren Wesenskern des Individuums hinaus ins Umfeld aufbläht, desto verletzbarer ist die Person, wenn solche Bedingungen durch Traumata verlorengehen. Je mehr das Selbstwertgefühl von verlierbaren Faktoren abhängt, desto vulnerabler ist die Person. Je mehr es in nicht verlierbaren Funktionen verankert ist, desto widerstandsfähiger ist sie.
Der gemeinsame Nenner aller Resilienzfaktoren ist die Definition des Selbstbilds auf Basis autonomer Fähigkeiten, die Abhängigkeit vermindern und Selbstbestimmung sichern. Beruht das Selbstbild auf autonomen Vermögen des Selbst, bildet es eine feste Struktur, an der das Trauma abprallt.
Introspektion bündelt die Aufmerksamkeit nach innen und sammelt Erkenntnisse, die das Selbstbewusstsein der Person steigern. Je mehr die Person ihrer selbst bewusst ist, desto eher kann sie Entscheidungen treffen, die mit ihrem Wesen übereinstimmen und den Rückschlag der Traumatisierung ausgleichen.
Selbstvertrauen ist die Bereitschaft, eigene Impulse auszuführen oder nach bewusster Abwägung Entscheidungen zu treffen, die der Ausführung von Impulsen widersprechen. Wer sich vertraut, vertraut darauf, dass seine spontanen oder reflektierten Urteile über die Wirklichkeit verlässlich sind. Er hat den Mut, sich seinen Urteilen anzuvertrauen.
Zuversicht liegt in der Erwartung, dass ausgeführte Impulse und getroffene Entscheidungen zu Ergebnissen führen, die im Interesse des Individuums sind. Selbstvertrauen und Zuversicht fasst die Resilienzforschung unter dem Begriff Selbstwirksamkeitserwartung zusammen (Bandura 1977).
Verantwortungsbereitschaft führt dazu, dass das Individuum die Lösung eigener Problem aktiv angeht, statt zu erwarten, das andere sich für zuständig erklären. Verantwortungsbereitschaft heißt zugleich, Fehlentwicklungen, die durch eigene Entscheidungen entstanden, nicht anderen zur Last zu legen... und dadurch bei Fehlern lernfähig zu sein.
Kommunikationsbereitschaft führt zur Bildung zwischenmenschlicher Netzwerke und zur Einbindung in soziale Gemeinschaften. Durch die Bereitschaft, sich mitzuteilen und einzugeben, stellt das Individuum selbständig die Erfüllung seines Zugehörigkeitsbedürfnisses sicher. In der Einbindung findet es Rat, Trost, Vorbild, Ermutigung, Stütze und Schutz. Es erfährt, dass auch andere schwere Schicksalsschläge erlitten, ohne davon auf Dauer gezeichnet zu sein.
Das Selbstwertgefühl ist autonom, wenn es nicht von Bedingungen abhängt, auf die das Individuum keinen ungeteilten Einfluss hat. Bedingungen sind umso unkontrollierbarer, je mehr sie von anderen Personen oder gesellschaftlichen Ereignissen bestimmt werden.
Ein religiöses oder spirituelles Selbstbild relativiert die Bedeutung der Person. Es sieht das Individuum in einem erweiterten Zusammenhang, auf den momentane Wechselfälle des Lebens wenig oder keinen Einfluss haben. An der Gewissheit, etwas anderes zu sein als das, was erschüttert werden kann, prallt jede Erschütterung ab.
Schrumpfung und Weite
Die Macht des Traumas trifft das Sicherheitsgefühl des Individuums. Wie ein Blitzlicht, das einen Drachen zeigt, der im Dunkeln lauert, führt sie ihm Ohnmacht, Zerbrechlichkeit und Ausgeliefertsein vor Augen. Nicht dass das Individuum vom Drachen gar nichts wusste, dass er jedoch tatsächlich da ist, hatte es verdrängt. Helfer beim Verdrängen waren Krücken und Illusionen aller Art, die die Bedeutung der Person scheinbar über ihr tatsächliches Maß erhöhten: Wohlstand, Erfolg, Anerkennung, Wissen, Beliebtheit, Rang, ein begehrenswerter Partner. Das aufgeblähte Selbstbild, das scheinbare Sicherheit verlieh, erweist sich im Blitzlicht des Traumas als Illusion.
Ob sich eine PTBS entwickelt, hängt auch davon ab, ob das bedrohliche Ereignis durch andere Personen oder höhere Mächte verursacht wird. Ist die Ursache ein menschlicher Täter, kommt die PTBS häufiger vor. Das hat psychologische Gründe.
Höheren Mächten - Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Asteroideneinschlägen, Pestepidemien, Lawinenabgang - gestehen wir die Blindheit zu, rücksichtslos gegenüber Leib und Leben irdischer Kreaturen zu sein. Von Menschen erwarten wir anderes: den Respekt und die Solidarität derer, die wie wir blinden Mächten ausgeliefert sind. Wir erwarten nicht Feindselig- oder Achtlosigkeit, sondern den Beistand von Schicksalsgenossen. Erleben wir das Gegenteil der erhofften Solidarität, untergräbt dies das Urvertrauen in die menschliche Gemeinschaft. Deshalb ist es seelisch leichter zu verkraften, durch einen umstürzenden Baum verkrüppelt zu werden als durch einen betrunkenen Schläger oder einen Folterknecht.
Die Vielfalt individueller Varianten seelischer Abläufe ist unermesslich; ebenso die Vielfalt situativer Umstände, mit denen eine Person konfrontiert werden kann. Die Posttraumatische Störung geht daher fließend in andere Kategorien über, die von der WHO als Krankheiten abgegrenzt werden.
Reaktionen auf schwere Belastungen
gemäß ICD-10-Klassifikation der WHO
| Name | ICD | Zeitlicher Verlauf |
| Akute Belastungsreaktion | F43.0 | Unmittelbar nach dem Ereignis. Maximal einige Tage andauernd. |
| Posttraumatische Belastungsstörung | F43.1 | Meist mit Latenz von einigen Wochen. Kann Monate lang andauern. |
| Anpassungsstörung | F43.2 | Hängt stark von den Umständen ab, die zur Störung führen. |
| Andauernde Persönlichkeitsveränderung | F62 | Langzeitfolge unverarbeiteter Erschütterungen |
Zwischen den Kategorien gibt es alle erdenklichen Vermischungen und Übergänge. Ein weiterer Übergang ist der zur Anhaltenden Trauerstörung. Darüber hinaus können sensitive Persönlichkeiten nach einer ehrverletzenden Erfahrung einen sensitiven Beziehungswahn (Kretschmer 1918) entwickeln.
Der Begriff subsyndromal benennt abgeschwächte Verläufe der Posttraumatischen Belastungsstörung. Je nach Ausmaß des Traumas wird das Selbstbild des Betroffenen unterschiedlich stark erschüttert. Dazu kommt, dass die individuelle Bereitschaft, Erschütterungen des Selbst- und Weltbilds zu akzeptieren, ebenfalls unterschiedlich ist.
Subsyndromale Verläufe können durch die gleiche Palette an erschütternden Ereignissen ausgelöst werden wie das Vollbild der PTBS. Dazu kommen aber auch weniger dramatische Bedrohungen für Leib und Leben (Unfälle und Krankheiten aller Art) und vor allem seelische "Verletzungen", die im Rahmen zwischenmenschlicher Konflikte auftreten.
Abgeschwächte Formen der PTBS kennt daher praktisch jeder. Sie plagen uns nach Kränkungen, durch die wir uns entwertet fühlen oder nachdem unser Selbstbild durch eigene Schuld hässliche Kratzer bekam. Wir sind dann nervös, reizbar und unzufrieden. Die Erinnerung an das Trauma kriecht nachts über die Bettdecke. In Gedanken kauen wir alles immer wieder durch. Solange wir mit dem Verkraften des Ereignisses beschäftigt sind, haben wir an anderem nur wenig Interesse.
Die akute Belastungsreaktion folgt dem äußeren Ereignis in der Regel unmittelbar. Sie klingt nach Stunden bis Tagen wieder ab. Typischerweise findet man Symptome, die alltagssprachlich als Schock oder Nervenzusammenbruch bezeichnet werden:
Eine Amnesie ist eine Erinnerungslücke. Ist sie retrograd, fehlt die Erinnerung an das, was vor dem erschütternden Ereignis passierte. Ist sie anterograd, fehlt die Erinnerung an die Zeit unmittelbar nach dem Ereignis.
Während akute Belastungsreaktionen und die PTBS ausschließlich durch punktuelle Ereignisse ausgelöst werden, folgen Anpassungsstörungen sowohl belastenden Einzelereignissen als auch dauerhaften Veränderungen der Lebensumstände, an die sich der Betroffene nur zögerlich oder gar nicht anpassen kann.
Auslöser von Anpassungsstörungen
Zu den typischen Symptomen von Anpassungsstörungen gehören...
Vor allem bei Jugendlichen kann es außerdem zu deutlichen Störungen des Sozialverhaltens, bis hin zu Straffälligkeit und Abgleiten ins Drogenmilieu, kommen.
Folgt eine krankhafte Störung einem äußeren Ereignis, stellt sich die Frage der Entschädigung. Wer krank wird, weil ihn von außen etwas traf, der ist ein Opfer... und wo ein Opfer ist, da ist ein Täter, dem das Leid des Opfers zur Last gelegt werden kann.
Da der Mensch dazu neigt, die Verantwortung für eigenes Leid einseitig anderen zuzuschreiben, sucht auch die Psychiatrie eine Friedensgrenze. Nur wenn die Wucht des Ereignisses so groß war, dass es quasi jeden hätte krank machen können, gestattet sie dem Symptomträger, die Rolle eines eindeutigen Opfers für sich in Anspruch zu nehmen.
Liegt die Wucht der äußeren Umstände und Ereignisse unterhalb der definierten Schwelle, wählt die Psychiatrie andere Begriffe. Man hat...
keine Störung durch eine Belastung erlitten...
Der Begriff Trauma, der in die Diagnose einer PTBS eingewoben ist, verlegt den Schwerpunkt der Verantwortung auf den externen Auslöser oder den Täter.
... sondern man reagiert akut auf etwas...
Als akute Belastungsreaktion zählt nur, was kurze Zeit danach wieder verschwunden ist... und da es keine Störung, sondern eine Reaktion ist, liegt die Verantwortung beim Betroffenen, weil er es schließlich ist, der problematisch reagiert.
Die Posttraumatische Belastungsstörung heilt entweder aus oder sie geht in eine dauerhafte Veränderung der Persönlichkeit über. Zu den Symptomen der Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung gehören:
Bedeutung des Vertrauens
Auch das Symptomspektrum der Andauernden Persönlichkeitsänderung erklärt, warum die Häufigkeit der PTBS bei Unfällen und Naturkatastrophen niedriger liegt, als nach Traumata, die absichtlich durch andere Menschen verursacht wurden. Ist der Verursacher ein Mensch, stellt das Trauma über die Erschütterung des Selbstbilds hinaus das Urvertrauen in die Solidarität der menschlichen Gemeinschaft in Frage. Das führt gehäuft zu Bindungsstörungen mit sozialem Rückzug, was seinerseits einen Verlust des zwischenmenschlichen Erlebnisraums bedingt.
Die Behandlung der PTBS steht wie die der übrigen reaktiven Störungen auf zwei Beinen.
Als eindeutig wirksam haben sich vor allem Antidepressiva erwiesen. Sie helfen, Ängste und depressive Reaktionen abzuschwächen oder aufzuheben. Als Mittel der ersten Wahl gelten heute...
Außerdem haben sich folgende Substanzen als potenziell wirksam erwiesen:
Vom theoretischen Ansatz her ist die psychotherapeutische Behandlung der PTBS einfach: Es gilt, die Verdrängung zu beenden und das erschütternde Erlebnis ins Selbstbild des Betroffenen aufzunehmen. Je nach Ausmaß der Traumatisierung und je nach individueller Struktur der innerseelischen Befindlichkeit, auf die das Trauma traf, ist das in der Praxis jedoch schwierig.
Im therapeutischen Prozess wird die Erinnerung an das Trauma wachgerufen. Wesentliches Ziel ist, die zugehörigen Gefühle und Stimmungen als sinnvolle Elemente der eigenen biographischen Entwicklung zu durchleben und anzunehmen. So wird das alte Selbstbild, das bis dahin nur durch mühsame Verdrängung und zum Preis quälender Symptome aufrechterhalten werden konnte, in ein neues Selbstbild überführt.
Da ein Selbstbild aber erst dann in die Persönlichkeit integriert ist, wenn es die Verhaltensmuster der Person spannungsfrei bestimmt, ist viel Arbeit nötig, um die Beziehung des Individuums zu sich selbst und zur Umwelt neu zu gestalten. Bei gründlicher Bearbeitung fallen eine Menge alter Zöpfe ab.
Die Zöpfe, um die es dabei geht, sind jene Einbeziehungen des Umfelds in die Selbstwertregulation des Individuums, die ihm dabei im Wege stehen, der Wirklichkeit als gestraffte, in sich konsistente Person entgegenzutreten, an deren Festigkeit die Verunsicherung des Traumas abgeprallt ist. In der Therapie geht es darum, bislang fehlende Resilienzfaktoren nachzurüsten.