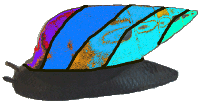
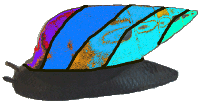
Als Erleuchtung wird die Schlüsselerfahrung der mystischen Religiosität bezeichnet. Synonym kann vom Erwachen gesprochen werden.
Die Vorsilbe Er-, mit der beide Begriffe anheben, kündigt einen Übergang an. Erleuchten heißt sehend machen. Erwachen heißt wach werden. Wach zu sein ist Voraussetzung des Sehens. Leuchten geht wie Licht auf die indoeuropäische Wurzel leuk- = leuchten, strahlen, funkeln zurück. Den Erleuchteten füllt der Funke eines transzendenten Lichts. Es ist derselbe Funke, der in jedem Bewusstsein zu finden ist, der das normale Bewusstsein jedoch nicht ausfüllt, weil er von anderem überdeckt wird.
Wach gehört zum Verb wachen. Wie es im Substantiv Wache anklingt, heißt wachen auf etwas aufpassen. Wachen seinerseits ist eine Abwandlung des germanischen Verbs wekan = munter sein, dem leicht hörbar unser heutiges wecken entspringt. Ein Wecker ist ein Muntermacher; obwohl ihn keineswegs jeder so positiv betrachten mag.
Wekan ging aus dem indoeuropäischen ueḡ- = frisch sein, stark sein hervor. Zum selben Stamm gehören altindisch vāja-ḥ = Kraft, Schnelligkeit und lateinisch vegere = munter sein, dem das Fremdwort Vegetation entspringt. Die Vegetation keimt munter aus dem Boden, sobald die Sonne scheint. Auch das deutsche Adverb wacker ist mit den Genannten verwandt. Etwas wacker anzugehen heißt, nicht lange mit der Ausführung eines Vorhabens abzuwarten und viel Kraft bei der Umsetzung aufzuwenden.
Unio mystica
Die europäische Mystik spricht von einer Unio mystica. Ausgehend von der dualistischen Vorstellung eines Gegensatzes zwischen Mensch und Gott deutet sie die Erfahrung als eine Überbrückung der dualistischen Polarität und damit als Vereinigung des Abgetrennten mit dem Absoluten. Bezieht man die tiefere Bedeutung des Wortes Mystik in das Verständnis der Unio mystica mit ein, ist von einer schweigenden und gegebenenfalls verschwiegenen Vereinigung zu sprechen.
In der Tat ist die entsprechende Vereinigung nichts, was durch einen verbalen Akt, sei er bloß gedacht oder als Gebetsformel ausgesprochen, zu vollziehen wäre. Dem Wesen des Ereignisses entspricht es ebenso wenig, dass man seine Erfahrung an die große Glocke hängt. Geht jemand umher und ruft: Schaut nur! Ich bin erleuchtet und sehe etwas, was ihr nicht seht, käme der Verdacht auf, dass er etwas für Erleuchtung hält, was keine ist. Es gibt religiöse Umfelder, die der mystischen Erfahrung derart ablehnend gegenüberstehen, dass sogar Verschwiegenheit geboten sein kann. Das Individuum, das nach Freiheit strebt, ist irdischer Macht ein Dorn im Auge.
In außereuropäischen Sprachen wird das Erleuchtungserlebnis als Satori (japanisch: さとり = Verstehen), Bohdi (Sanskrit: बोधि = Erwachen) bzw. Samadhi (Sanskrit: समाधि = Versenkung, Sammlung) bezeichnet. Der Erleuchtete versteht etwas, was er bislang nicht verstanden hat. Statt an die Oberfläche des sinnlich Erkennbaren gefesselt zu sein, versenkt er den Blick in eine Tiefe, in der die Gegensätze des Erkennbaren zur ursprünglichen Einheit versammelt sind.
1 Moses 1, 27:*
So schuf Gott den Menschen nach seinem Abbild, nach Gottes Bild schuf er ihn...
Lukas 23, 34:*
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Der Begriff Gott hat den Vorteil, eine vertraute Vorstellung aufzurufen. Als religiöse Metapher ist er gut verwendbar, da er das Gottesbild der dominanten Religionsauffassung zum Ausdruck bringt, mit dem jeder sofort etwas anfangen kann. Der Begriff weckt spontan Interesse und motiviert zum Engagement, indem er ankündigt, dass von etwas Wichtigem die Rede ist.
Blickt man jedoch über die Vorstellungswelt der dualistischen Theologie hinaus, werden die Grenzen des Begriffes deutlich. Gemäß mystischer Theologie kann das Absolute eben nicht als separate personale Einheit aufgefasst werden, weil der dualistische Gottesbegriff Gott zum Objekt menschlicher Hinwendung und Anbetung reduziert. Das tatsächliche Wesen Gottes wird besser durch den Begriff Gottheit benannt, der von Meister Eckhart geprägt wurde. Gottheit umfasst mehr als eine Person, zu der man betet.
Betrachtet man das Thema aus dem Blickwinkel der Psychologie, ist der Begriff absolutes Selbst eine gute Wahl, weil er das Gemeinte benennt ohne ihm voreilig bestimmte Eigenschaften zuzuweisen. Allerdings fehlt dem absoluten Selbst die poetische Würze, die Gott inneliegt. Absolutes Selbst: Das klingt abstrakt und akademisch. Und doch: Wie heißt es an der hellsten Stelle der Bibel?
2 Moses 3, 14:*
Gott entgegnete dem Moses: "Ich bin, der ich bin!"
Religiosität befasst sich mit dem Transzendenten. Sie befasst sich mit dem, was jenseits der sinnlichen Wahrnehmung liegt. Das ist allen Varianten religiösen Ausdrucks gemeinsam. Innerhalb des Spektrums religiöser Ausdrucksformen gibt es jedoch eine Wasserscheide:
Die dualistische Realitätsdeutung betrachtet Religion als Anbetung eines göttlichen Gegenübers.
Obwohl beide Ansätze kategorisch zu unterscheiden sind, spricht im Grundsatz nichts dagegen, sie in religiösen Fragen parallel zu verwenden. Beide können zu einer gesunden seelischen Entwicklung beitragen. Die Gefahr gegenläufiger Effekte ist bei der dualistischen Auffassung jedoch größer, während nur der monistische Ansatz die Chance bietet, den Menschen vollständig aus seiner Egozentrik zu befreien. Vollgültige Religion ist keine Unterwerfung des Egos, sondern Befreiung aus der Egozentrik.
Zu leben ist gefährlich. Das ist eine Erfahrung, die selbst Mäusen im Gewebe sitzt und die nicht nur deren Bauplan, sondern auch ihr Verhalten mitbestimmt. Während sich Mäuse über die Wirklichkeit wohl kaum Gedanken machen, versucht der Mensch, die Welt zu verstehen, um sich vor den Gefahren des Daseins gezielt zu schützen. Dabei untersucht er nicht nur die Unterschiede zwischen genießbaren und ungenießbaren Pilzen. Er stellt grundsätzliche Überlegungen an.
Schon früh wurde dem Menschen klar, dass er bei der Abwehr von Gefahren zwar viel aus eigener Kraft bewirken kann, dass er der Wirklichkeit zugleich aber bei weitem mehr ausgeliefert bleibt, als dass er sie beherrschen könnte. Das gilt auf zweierlei Art. Der Mensch kann sich weder als Einzelner dem Ausgeliefertsein aus eigener Kraft entziehen noch durch die gebündelte Anstrengung aller.
Der Erkenntnis, dass es Faktoren gibt, die unüberwindbar über das Schicksal des Menschen bestimmen, folgte die Idee jenseitiger Kräfte, deren Werk das Schicksal ist und deren Entscheidungen man, analog zu den Entscheidungen eines irdischen Machthabers, durch wohlgefälliges Verhalten beeinflussen kann. Die Idee eines Gottes oder einer Götterwelt, denen man Bitten zuträgt und deren Wohlmeinen man sich durch Unterwerfungsgesten, Grußbotschaften und Opfergaben versichert, war geboren.
Hätte die Anbetung von persönlichen Göttern keine positiven Effekte, würde sie in der Menschenwelt kaum so viel Anklang finden. Der Gläubige, der seinen Gott anruft, geht logischerweise davon aus, dass gegebenenfalls positive Wirkungen von dem Gott ausgehen, dessen Entscheidungen er durch die Anbetung beeinflusst. Er glaubt, erhört zu werden; oder die Wahrscheinlichkeit dazu durch die Anbetung zumindest zu erhöhen. Sonst wäre er nicht gläubig.
Aber auch ungeachtet dessen, ob Gott die unzähligen, oftmals miteinander unvereinbaren Anliegen seiner Anbeter tatsächlich zur Kenntnis nimmt oder nicht, haben Gebete und glaubenskonforme Rituale positive psychologische Effekte.
Wer glaubt, dass er sich durch Gebete die Gunst höherer Mächte verschaffen kann, sieht die Zukunft nach vollzogenem Gebet in einem hoffnungsvollen Licht. Das Gleiche gilt für den, der Gebeten die Macht zuschreibt, ihn vor dem Zorn Gottes zu beschützen. Resultat ist weniger Angst. Beten beruhigt.
Opfert Gregorios Aphrodite Blumen, weil er um deren Beistand bei der Eroberung der schönen Eunike bittet, so kann ihn der Glaube an die Unterstützung der Göttin so beflügeln, dass seine Werbung viel charmanter rüberkommt, als wenn sich auf seine kaum herkuleische Gestalt verlassen müsste. Gregorios verdingt sich als Schreiber. Beim Speerwurf ist er eine Niete. Beten ermutigt.
Eine besondere Rolle spielt der Glaube an die Macht der Anbetung im Krankheitsfall. Hier geht der psychologische Effekt nahtlos in physiologische Wirkungen über, die über Siechtum und Heilung entscheiden können. Die psychosomatische Kopplung von Körper und Seele führt dazu, dass die Entängstigung, die durch die Anbetung Gottes erzielt wird, auf körperlicher Ebene eine verminderte Ausschüttung sogenannter Stresshormone bewirkt. Dazu gehören Katecholamine und Glukokortikoide. Da Stresshormone auf Dauer zu schweren gesundheitlichen Störungen führen können, kann die Senkung ihrer Plasmaspiegel umgekehrt auch schwere Krankheitssymptome zur Abheilung bringen.
In der Medizin kennt man analoge Effekte als Plazebowirkung. Der schiere Glaube, dass die Einnahme eines Medikamentes heilsam ist, reicht oft aus, um Heilung zu erreichen. Dabei sollte der Begriff Plazebo nicht abwertend verwendet werden. Zuversicht als Wirkkraft ist ein hohes Gut, das zu belächeln die Eitelkeit jener verrät, die allzu stolz auf ihre Taten sind.
Die religiöse Präsenzgewissheit beruht auf einer anderen Wirklichkeitsdeutung als die Gottesanbetung. Der Gottesanbeter sieht Gott als eine Person, die der eigenen gegenübersteht. Damit wendet er sich an eine Instanz, die von ihm selbst entrückt im Jenseits thront und von dort aus die Geschicke lenkt. Dieses Bild ist dualistisch. Es sieht zwei Instanzen: Gott und den Anbeter. Jede Instanz hat ein eigenes Selbst, ohne dass es zwischen beiden eine substanzielle Verbindung gäbe. Beide Instanzen sind somit füreinander Objekt.
Singularität
Die Sprache ist vielsagend. Sie kennt den Begriff das Selbst. Einen Plural davon kennt sie nicht.
Das Streben nach der Präsenzgewissheit ist monistisch. Es setzt keine substanzielle Trennung von Schöpfer und Geschöpf voraus. Vielmehr sieht sie das Göttliche als Subjektivität, der man nicht begegnen kann, als sei sie ein Gegenüber, sondern von der man bloß ausgehen kann, sofern man ihre Präsenz in und als sich selbst annimmt.
Gott primär als Subjektivität zu deuten, setzt intellektuelles Abstraktionsvermögen voraus. Das Subjekt ist eben kein Objekt und damit nichts, was man an bestimmten Eigenschaften sinnlich erkennen könnte. Daher ist es kaum verwunderlich, dass der Mensch dazu neigt, sich Götterbilder anzufertigen, also konkrete Objekte, an die man sich wenden kann.
Religion kann als individueller Bezug zwischen dem Einzelnen und Gott betrachtet werden oder als soziale Angelegenheit. Wird Religion als soziale Angelegenheit betrieben, überlagern ihre Muster den individuellen Bezug. Soziale und im nächsten Schritt politische Interessen erheben Anspruch darauf, über den ursprünglich individuellen Bezug zu bestimmen. Das kann zu einem Konflikt zwischen der dualistischen und der monistischen Religionsauffassung führen.
Religion: Ich mache erste Schritte und entscheide unterwegs, wie es jeweils für mich weitergeht.
Wohlgemerkt: Es kann zu einem Konflikt führen. Es muss aber nicht. Das zeigt der religiöse Pluralismus Indiens. In Indien gedeihen dualistische Anbetungskulte verschiedenster Art neben monistischen Auffassungen, ohne dass es zwischen all diesen Formen zu grundsätzlichen Feindseligkeiten käme. Im abrahamitischen Kulturkreis ist das anders. Das liegt an der Offenbarungsbehauptung und der daraus resultierenden Konfessionalität.
Die Kernaussage des Advaita greift die altindische Sichtweise auf, dass das Ich des Einzelnen Ausdruck der kosmischen Einheit ist und dieser, entgegen äußerem Anschein, nicht gegenübersteht, sondern unauflösbar in sie eingebettet ist.
Die abrahamitische Tradition geht von der Offenbarungsbehauptung aus. Gemäß ihrer Wirklichkeitsdeutung ist Gott eine entrückte Person, die auserwählte menschliche Personen dazu beauftragt, an ihrer statt Politik zu machen. Da es dem Interesse jeglicher Machthaber entspricht, sich Konkurrenten vom Hals zu halten, ist es folgerichtig, einen Gott auszurufen, dem nichts wichtiger ist, als sich selbst gegen Konkurrenz zu verwahren. Das erste Gebot steht nicht zufällig an erster Stelle.
2 Moses 20, 3:*
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben!
Der Glaube an einen solchen Gott entspricht einer klaren Botschaft: den Herrschaftsanspruch seiner Vertreter niemals infrage zu stellen. Kein anderer Gott = kein anderer Ritus = keine andere Herrschaft.
Versteht man Religion als Politik im göttlichen Auftrag, ist der Konflikt zwischen dualistischer und monistischer Wirklichkeitsdeutung vorprogrammiert. Das primäre Kernmotiv aller Politik ist die Kontrolle von Konkurrenten. Je nach Radikalität des Vorgehens wird Konkurrenz entweder eingedämmt oder brachial beseitigt. Da die Wertschätzung potenzieller Konkurrenten ihre Beseitigung behindert, liegt es ebenfalls im Interesse politischer Religion, Vorstellungen aus der Welt zu schaffen, die dem Menschen an sich einen unumstößlichen Wert beimessen. Genau das tut aber die monistische Religionsauffassung. Sie geht von der Präsenz Gottes im Einzelnen aus.
So wie es kein Zufall ist, dass das erste Gebot an erster Stelle steht, ist es auch kein Zufall, dass der Mythos von der Vertreibung aus dem Paradies ganz am Anfang der Bibel zu finden ist; denn dieser Mythos erklärt die monistische Auffassung zum Teufelswerk. Zwei Textstellen des Alten Testaments sind von entscheidender Bedeutung:
1 Moses 3, 5 - 6:*
Vielmehr weiß Gott, daß euch, sobald ihr davon eßt, die Augen aufgehen und ihr... Gutes und Böses erkennt... Da sah die Frau, daß der Baum gut sei... um weise zu werden.
1 Moses 3, 22:*
Dann sprach er:" Ja, der Mensch ist jetzt wie einer von uns geworden, da er Gutes und Böses erkennt. Nun geht es darum, daß er nicht noch seine Hand ausstrecke, sich am Baum des Lebens vergreife, davon esse und ewig lebe."
Erkenntnis ist der entscheidende Schritt zur Erleuchtung. Ihr Ausdruck ist Weisheit, ihr wesentlicher Inhalt die Gewissheit, dass das Selbst nicht mit der Person zusammenfällt, sondern substanziell ins Absolute übergeht. Die Verteufelung der Erkenntnis zugunsten blinden Glaubens ist eine grundsätzliche Ablehnung mystischer Religiosität.
Da das Absolute über der Zeit steht, ist auch das Selbst des Einzelnen der Zeit zuletzt enthoben. Da die monistische Spiritualität das bewusst zu machen versucht, wirkt sie dem Machtanspruch dualistischer Kulte entgegen; deren Kernidee Spaltung und Hierarchie, aber nicht Einheit ist.
Wir haben gesehen: Die dualistische Anbetung personifizierter Götter und die monistische Suche nach Erleuchtung schließen sich im Grundsatz nicht aus. Das erste kann das zweite vorbereiten. Erst wenn der dualistische Kult von politischen Zielen vereinnahmt wird, geraten beide Ansätze miteinander in Konflikt.
Überflüssige Vergleiche
Für den einen ist Gott eine Macht, vor der er niederkniet, für den anderen ist er die Gegenwart, die er in sich trägt. Ehren Sie Gott, indem Sie als seine Gegenwart aufrecht gehen. Knien Sie vor niemandem nieder; auch nicht vor ihm. Wer vor Gott kniet, meint, dass Gottes Größe im Vergleich zur eigenen groß ist. Damit erkennt er nicht Gottes Größe an, sondern verkleinert, was davon in ihm liegt. Gottes Größe ist keine Größe, die im Vergleich zu etwas Kleinem groß ist, sondern eine, die über jeden Vergleich hinausgeht. Auf Gottes Größe kann man nicht durch einen Meter Unterschied verweisen, den man ihm zusätzlich zugesteht. Man verweist darauf, indem man das, was man ist, nicht kleiner macht, um groß zu werden.
Die Offenbarungsbehauptung postuliert, dass Gott einzelnen Personen eine besondere Rolle zuweist, nämlich die, seine Wünsche gegenüber allen übrigen gegebenenfalls gewaltsam durchzusetzen. Solche besonderen Personen nennt die Tradition Propheten ( = Vorsprecher). Ihre Erben nennen sich Priester. Priester geht auf Griechisch presbyteros [πρεσβυτερος] = Ältester zurück. Zweifellos ist mit dem Ältesten kein kalendarisches Alter gemeint. Sonst könnten Anwärter erst mit 80 zum Priester ernannt werden. Der Älteste steht für verehrungswürdig, so wie es im veralteten Hochwürden und im englischen Reverend (to revere = verehren) ausgedrückt wird. Dualistische Religion verstärkt die Egozentrik ihrer Repräsentanten, indem sie deren Personen besondere Bedeutungen zuschreibt. Egozentrik ist der Glaube an ein autonomes Selbst, das Gott gegenübersteht.
Die monistische Auffassung postuliert etwas anderes. Sie geht davon aus, dass das Göttliche in jeder Person von je her präsent ist... und es daher keine besonderen Personen gibt, die kategorisch über anderen stehen. Teilhabe am Göttlichen ist nichts Besonderes, sondern etwas Alltägliches. Mehr noch: Da die dualistische Auffassung der Offenbarungstheologie zwischen Gott und Mensch spaltet, ist die definitorische Nähe ihrer Propheten zu Gott geringer, als es die entsprechende Nähe eines jeden Laien gemäß monistischer Auffassung ist. Während der sogenannte Prophet ein kategorisch anderer als Gott ist, fasst die Mystik jedes Wesen als dessen unmittelbaren Ausdruck auf. Für die Mystik erschafft Gott die Welt nicht neben sich, als ob es neben ihm etwas anderes gäbe. Er entwirft die Welt aus und in sich, sodass seiner Einheit niemals etwas anderes entgegensteht.
Die Grundlage des Bezugs zwischen Mensch und Gott bleibt im Dualismus folglich der Gehorsam, der, solange sich Gott nicht persönlich blicken lässt und deren Ansprüche bestätigt, den Repräsentanten des Glaubens gegenüber abzuleisten ist.
Sura 4, 17-18:**
... wer Gott gehorcht und seinem Gesandten... wer sich aber auflehnt gegen Gott und seinen Gesandten...
Gemäß monistischer Auffassung entsteht der Bezug zwischen Mensch und Gott durch Selbstbewusstheit. Auf gesellschaftlicher Ebene haben die Unterschiede weitreichende Folgen. Der Kult um Hierarchie und Gehorsam festigt entsprechende Muster auf politischer Ebene. Er fördert asymmetrische Sozialstrukturen. Dort wo er explizit von politischen Kräften vereinnahmt wird, führt er zu Expansionismus, Diktatur und Militanz. Eine Gesellschaft im religiösen Sinne selbstbewusster Individuen ist gegen solche Entwicklungen weitgehend gefeit.
Zu unterscheiden sind zwei Funktionsmuster des Bewusstseins. Der Erleuchtete geht vom einen ins andere Funktionsmuster über.
Ausgangslage
Im normalen Muster misst der Mensch seiner Person und allem, was sie unmittelbar angeht, große Bedeutung zu. Sein Handeln ist weitgehend darauf ausgerichtet, persönliche Vorteile zu erlangen und Nachteile abzuwehren, die sein Wohlbefinden beeinträchtigen könnten. Dabei deutet der Mensch sich als Partikel eines Erfahrungsfeldes, in dem sein Ich als autonome Einheit auf die Welt trifft und mit deren Kräften ringt. Die Welt wird dabei als ein Nicht-Ich aufgefasst, das aus unbelebten und belebten Elementen besteht, die sich ihrerseits begegnen, ohne untereinander wesentlich verbunden zu sein. Seine Mitmenschen sieht die Person in normalen Modus ebenfalls als autonome Einheiten, deren Verbindung ausschließlich durch Interaktion zustande kommt, also durch Akte wechselseitiger oder einseitiger Einflussnahme. Im normalen Muster bleibt das Ich ausschließlich mit der Person identifiziert, also mit der Rolle, die es als psychosomatischer Organismus im Umfeld spielt und mit dem Bündel besonderer Erscheinungsformen, die als relatives Selbst definierbar sind.
Zielpunkt
Im erleuchteten Muster hat das Ich die einseitige Identifikation mit der Person hinter sich gelassen. Es sieht sich nicht bloß als Person, sondern als sich selbst. Das Selbst, mit dem es sich nun identisch fühlt, gilt ihm weder als separate Einheit, die anderen Einheiten mit ebenfalls separatem Selbst begegnet, noch als etwas sekundär Entstandenes. Vielmehr gilt ihm die Identität mit dem Selbst als primärer Ausgangspunkt, dem sämtliche Identifikationen mit Teilaspekten der Wirklichkeit nachgeordnet sind.Das absolute Selbst tritt als Polarität in Erscheinung; ohne tatsächlich gespalten zu sein. Die primäre Polarität besteht aus Subjekt und Objekt. Im normalen Funktionsmuster identifiziert sich das Ich mit dem relativen Selbst. Zu dessen Bausteinen gehören der Körper als physikalisches Objekt sowie die Ausdrucksformen des persönlichen Bewusstseins (Gedanken, Impulse, Meinungen, Gefühle, etc.) als virtuelle Objekte. Das Ich betrachtet das Gefüge dieser Elemente als eigene Person und setzt sich damit gleich.
Im erleuchteten Funktionsmuster geht das Selbstverständnis des Ichs über das relative Selbst hinaus. Es erweitert sich ins absolute Selbst. Durch die Erleuchtung wird die Unbegrenztheit des absoluten Selbst erfahren, die im subjektiven Pol der Wirklichkeit zum Ausdruck kommt. Zugleich wird die Gleichsetzung des Ichs mit dem relativen Selbst zugunsten der Identität mit dem absoluten aufgegeben. Das relative Selbst wird als Ausdrucksform des absoluten aufgefasst, der gegenüber anderen Ausdrucksformen keine besondere Geltung mehr zu verschaffen ist. Der Erleuchtete hat kein Geltungsbedürfnis mehr, das den Frieden seiner Seele stören könnte.
Die Möglichkeit einer grundlegenden Transformation des Bewusstseins ist seit Jahrtausenden bekannt. Ebenso lange gibt es Menschen, die Mittel und Wege suchen, wie man die Transformation gezielt erreichen kann. Zum Spektrum der Erfahrungsformen, die dabei zum Zuge kommen, gehören zwei Prinzipien.
Spontane Erleuchtungserlebnisse treten unerwartet auf. Sie werden in der Regel als plötzliches Umschwenken des Wirklichkeitserlebens von der üblichen Form in eine völlig neue beschrieben. Dabei wird meist betont, dass die Beschreibung der neuen Erfahrung nur andeutungsweise auf deren tatsächliche Qualität verweisen kann. Zur Spontaneität solcher Erfahrungen gehört zudem, dass sie willentlich weder beliebig wiederholbar sind, noch dass man anderen eine verlässliche Wegbeschreibung liefern kann, die eine empirische Überprüfung möglich macht.
Die ungenügende Beschreibbarkeit solcher Erfahrungen bringt es mit sich, dass auch nicht zu entscheiden ist, wie groß die Übereinstimmung des jeweiligen Erlebens hinter den individuellen Beschreibungen ist. Trotzdem scheint etwas Einheitliches abzulaufen.
Spontane Erleuchtungserlebnisse sind keine Visionen. Es tauchen keine zusätzlichen Wahrnehmungsobjekte im Bewusstsein auf. Es erscheinen keine übernatürlichen Wesen. Es wird nichts halluziniert. Es sind weder Engel und Götter zu sehen noch verbalisierte Botschaften zu hören.
Um das Phänomen einer Hyperrealisation zu verstehen, ist der Vergleich mit einem psychiatrischen Symptom nützlich, das als gegenteilige Erfahrung aufgefasst werden kann: der Derealisation. Bei der Derealisation erlebt der Betroffene die Welt als unwirklich, entfremdet, entrückt, wie in Watte gepackt, mithin quasi verhüllt.
Die hyperreale Wirklichkeitserfahrung ist dem diametral entgegengesetzt. Die Wirklichkeit wird dabei nicht als fremd und entrückt, sondern als vollkommen zugehörig, offenbar und vertraut erfahren. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass Zugehörigkeit nicht nur ein psychologisches Grundbedürfnis ist, sondern als eschatologisches Prinzip der Nicht-Zweiheit logisch entspricht.
Die Psychodynamik der Erleuchtungserfahrung lässt sich verstehen, wenn man die normale Funktionsweise des Bewusstseins als einen Zwischenzustand zwischen Derealisation und Hyperrealisation betrachtet. Im normalen Modus erlebt das Ich die Welt als ein ihm gegenüberstehendes Nicht-Ich, das ihm somit eigentlich fremd und nur oberflächlich vertraut ist. Das normale Ich ist an die unvollständige Vertrautheit aber so gewöhnt, dass es sie nicht als bestimmte Qualität wahrnimmt. Bei der Derealisation wird weitere Vertrautheit eingebüßt. Der Betroffene erkennt, dass er die Welt bislang noch als relativ vertraut wahrnahm, nun aber nicht mehr. Das macht ihm Angst.
Bei der Hyperrealisation tritt das Gegenteil auf. Der Erleuchtete erkennt eine viel größere Vertrautheit mit der Wirklichkeit als bisher wahrgenommen. Ist die Erfahrung vollständig, wird zwischen Ich und Nicht-Ich keine Grenze mehr empfunden. Da das Nicht-Ich nun nicht mehr als etwas Fremdes erscheint, dem das Ich konflikthaft ausgeliefert ist, verschwindet das unterschwellige Gefühl der Bedrohung, das dem normalen Realitätsempfinden eingewoben ist.
Das Erlebnis völliger Vertraut- und Verbundenheit nimmt dem Ich jede Angst. Es wird als Frieden empfunden, als Stille jenseits eines jeden Kampfgetümmels, in das das Ich als bloße Person verwickelt ist. Das Ich erkennt sich selbst als Einheit von Person und Welt. Da der Konflikt zwischen Ich und Nicht-Ich überschritten wird, wird Liebe als bestimmende Farbe der Wirklichkeit selbstverständlich. Was keine Angst um sich selbst hat, ist Liebe. Liebe ist ein Weiß, das alle übrigen Farben zu sich vereint; selbst schwarz.
Wären Erleuchtungserfahrungen willentlich durchzuführen, lebten wir in einer anderen Welt. Wahrscheinlich hätte es nie einen Krieg gegeben. Wahrscheinlich gäbe es auch keine ökologischen Probleme, da der Mensch die Welt, in der er eingebettet ist, als einen Ausdruck des eigenen Wesens achten würde. Es ist aber nicht so. Ursache ist die Egozentrizität des normalen Realitätserlebens, die unverdrossen darüber wacht, dass die konzeptuelle Grenze zwischen Ich und Nicht-Ich bei der Konstruktion des Welt- und Selbstbilds bestehen bleibt.
Seine Egozentrizität ist dem Ich nicht übelzunehmen. Das Ego ist ein Hüter des persönlichen Bestands. Das Schicksal eines Ichs, das seinen Hüter bedenkenlos in die Wüste schickt, ist in einer Welt, die vor Gefahren für die Person nur so wimmelt, ziemlich offen. Kaum jemand tauscht deshalb die Dienste des Egos gegen die Freiheit ein, die ein Verzicht auf den Beschützer mit sich bringt. Lieber als Mündel des Beschützers leben, als ohne Schutz nicht zu wissen, was danach kommt.
Andererseits klingen die Verheißungen derer, die von entsprechenden Erfahrungen berichten, so verlockend, dass überall auf der Welt religiöse Traditionen entstanden sind, die Mittel und Wege suchen, das ersehnte Ziel der Entängstigung durch vorbereitende Übungen zu erreichen. Da den ostasiatischen Ländern die Unterdrückung der Mystik durch konfessionelle Glaubensformen ursprünglich erspart blieb, verwundert es nicht, dass die dortigen Traditionen den europäischen an Breite, Tiefe und Einfluss überlegen sind. Eine Skizze der kaum auslotbaren Geisteswissenschaft, die mit der spirituellen Suche verbunden ist, kann unter fünf Überschriften versucht werden:
Hinduistische Entsprechungen
Die hinduistische Tradition, vor deren Hintergrund auch die buddhistische entstanden ist, hat drei Wege zur mystischen Erfahrung beschrieben.
Jnana Yoga
Der Weg des Wissens
Karma Yoga
Der Weg des Handelns
Bhakti Yoga
Der Weg der Hingabe
Advaita macht klar, dass es sich hierbei nicht um getrennte Wege handelt, sondern um drei Ströme, die ineinanderfließen.
Nicht jede Meditation ist spirituell ausgerichtet. Meditative Techniken gibt es auch als Methoden zur Effektivitätssteigerung innerweltlicher Betriebsamkeit. Dann dienen sie zur Beruhigung des Geistes in einem hektischen Alltag, eines Geistes, der sie keineswegs dazu einsetzt, um die Person zu überschreiten, sondern um die Person zu festigen. Sie dienen keinem über die egozentrische Grundausrichtung der Psyche hinausreichenden Ziel. Zu nennen sind hier z.B. das Autogene Training, aber auch die Achtsamkeitsmeditation zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und zur psychosomatischen Entspannung.
Das Ziel der spirituellen Meditation liegt höher. Sie versucht, die Perspektive auf die Wirklichkeit grundsätzlich zu ändern, indem sie den Suchenden aus der Identifikation mit seiner Person herauslöst.
Die Identifikation mit der Person manifestiert sich durch die egozentrische Beschäftigung des Ichs mit deren Belangen. Wie hartnäckig diese egozentrische Bindung ist, kann jeder schnell entdecken, wenn er auf meditativem Wege versucht, sie zu lösen. Als erster Ansatz, der zum Ziel führen soll, dient meist der Versuch, sich auf ein einziges Meditationsobjekt zu konzentrieren. Das klassische Meditationsobjekt ist dabei der Atem. Es kann aber auch irgendeine Körperstelle sein, eine bestimmte Körperhaltung, die einzuhalten ist, ein geistiges Vorstellungsbild oder ein Objekt der Außenwelt: zum Beispiel eine Kerzenflamme oder eine Ikone.
Achtsames Spülen
Bloß weil Sie Ihr Geschirr von Hand spülen werden Sie noch nicht erleuchtet. Aber immerhin, es ist möglich. Wenn Sie jedoch eine Spülmaschine benutzen, sinkt Ihre Chance gegen Null.
Fast jeder stellt ein erstaunliches Unvermögen fest, seine Aufmerksamkeit auf Dauer beim Zielobjekt zu halten. Statt dass der Fokus der Aufmerksamkeit wie gewünscht beim Pendeln der Atmung verbleibt, taucht, kaum hat man es ein paar Atemzüge geschafft, der erste Gedanke auf, der offensichtlich so wichtig erscheint, dass er prompt dazu verführt, seinem Thema gedanklich zu folgen und die Atmung aus dem Fokus der Aufmerksamkeit zu entlassen.
Oh! Ich habe vergessen, das Handy vom Ladegerät abzustöpseln. Was, wenn der Akku, während ich hier sitze, durch Überladung beschädigt wird?
Symbol und Wirklichkeit
Gedanken entstehen beim Versuch des Subjekts, die Wirklichkeit durch Konzepte und Bilder zu verstehen. Die gedanklichen Vorstellungen sind aber nicht mehr die Wirklichkeit selbst, sondern deren symbolisierter Ersatz. Statt nach der Wirklichkeit Ausschau zu halten, läuft das Subjekt Gefahr, immer neue Bilder davon zu entwerfen, die als Vorstellungen den Blick auf die Wirklichkeit verstellen. Das zu tun ist deshalb so verführerisch, weil Bilder im Gegensatz zur Wirklichkeit leicht handhabbar sind. Beim Entwurf der Bilder erlebt sich das Subjekt unbewusst als Macher einer virtuellen Wirklichkeit, die sein Unterworfensein unter die tatsächliche überdeckt. Das denkende Ich glaubt, mächtig zu sein.
Lässt man die Psyche gewähren, folgen dem ersten Gedanken spontan weitere:
2. Gedanke
Käme ich nicht besser zur Ruhe, wenn ich das Ladekabel erst abkoppele und die Meditation dann neu beginne?
3. Gedanke
Bei der Meditation soll aber doch geübt werden, sich nicht ablenken zu lassen. Besser, ich bleibe sitzen und halte die Sorge aus.
4. Gedanke
Bin ich vielleicht deshalb so ablenkbar, weil ich nicht gerade sitze?
5. Gedanke
Mist! Jetzt bin ich schon wieder am Denken statt achtsam zu sein. Ich sollte den Gedanken loslassen und mich auf den Atem konzentrieren. Ob ich das jemals hinbekomme?
De facto sind die Inhalte des relativen Selbst virtuelle Objekte. Sie sind als relatives Selbst zu bezeichnen, weil wir dazu neigen, uns damit zu identifizieren. Je mehr wir uns von der Kettenreaktion des Denkens, Urteilens, Planens und Fühlens vereinnahmen lassen, desto fester wird die Identifikation. Wir übersehen, dass wir nicht das relative Selbst sind, sondern der Beobachter, der ihm so viel Bedeutung beimisst, dass er sich unentwegt damit befasst und sich mit seinen Absichten identifiziert.
Ziel der spirituellen Meditation ist es, diese Identifikation zu lösen. Also wendet man sich von aufkommenden Gedanken immer wieder ab und konzentriert sich auf ein ausgewähltes Objekt. Dadurch soll erreicht werden, dass schließlich keine Gedanken mehr aufkommen, also keine virtuellen Objekte, mit denen sich das beobachtende Subjekt irrtümlicherweise identifiziert. Als Folge soll der Geist zur Ruhe kommen, damit er, unabgelenkt durch die Betriebsamkeit der Person, sein reines Wesen erkennt.
Selbst wenn man das Grundprinzip der Fokussierung des Meditationsobjektes verstanden hat und bereit ist, es konsequent umzusetzen, ist der Weg zum Erfolg meist steinig und lang. Die meisten geben rasch auf.
Ein zweiter Ansatz im Umgang mit der Aufdringlichkeit des relativen Selbst und seiner mentalen Produkte, kann darin liegen, sich nicht von den Inhalten abzuwenden, sondern sie ihrerseits zu identifizieren und erkennbaren Merkmalen der Person zuzuordnen:
Aha! Jetzt befasse ich mich mit meinem Handy. Wie eifrig ich doch damit beschäftigt bin, mich vor jedem Schaden zu beschützen.
Jetzt befasse ich mich mit der Ablenkbarkeit im Allgemeinen. Offensichtlich will ich alles, was ich tue, optimieren.
Statt sich Denkprozessen zu überlassen oder sich vom Gedanken abzuwenden, wird zum Gedanken Abstand geschaffen, indem man ihn zum Objekt der Betrachtung macht.
Über Jahrtausende hinweg ist die Meditation ein wesentliches - wenn nicht sogar das wesentliche - Werkzeug der Spiritualität geblieben. Als eine Spielart der Meditation kann die Kontemplation aufgefasst werden. Bei der Kontemplation wird ein bestimmtes Thema, das mit der religiösen Befreiung zu tun hat, bewusst in den Fokus der Aufmerksamkeit gestellt. Dadurch versucht man nicht, die Wirklichkeit durch Abwendung und Distanzierung von Denkinhalten zu erkennen, sondern sich ihr durch ein durchgreifendes Durchdenken des Sachverhalts zu nähern, das schließlich zum Verstehen führt. Zu den typischen Themen der Kontemplation gehören...
Wohlgemerkt: Die beschriebenen Formen der spirituellen Meditation und Kontemplation sind keineswegs die einzigen. Es gibt zahlreiche weitere Varianten, die hier nicht erwähnt sind. Die Erwähnten sind jedoch geeignet, um die Grundprinzipien des meditativen Bemühens um mystische Erfahrungen zu beleuchten.
Die Kontemplation, also die intensive Beschäftigung mit religiösen Themen, ist ein verbreitetes Werkzeug zur zielgerichteten Arbeit am Bewusstsein, die tatsächlich hyperreale Erfahrungen vorbereiten soll. Kontemplatives Verständnis kann auch durch die Lektüre spiritueller Texte befeuert werden, durch die andere Sucher von den Erfahrungen ihrer Suche berichten oder Denkmodelle anbieten, die als Wegbeschreibung dienen.
Da die Kontemplation sich ausdrücklich auch intellektueller Mittel bedient, liegt ihr die Gefahr inne, letztendlich die egozentrische Bindung des Ichs an das relative Selbst zu festigen, statt sie definitiv zu lösen. In der Tat: Intellektuelle Mittel erzeugen Wissen. Wissen ist eine Ressource der Person, die sich damit besser zu positionieren versucht. Wissen kann zwar auch spirituellem Verständnis dienen, es kann aber auch mit wahrer Einsicht verwechselt werden. Der Wissende weiß dann zwar eine Menge, aber er versteht trotzdem nicht viel. Sein Wissen bleibt an der Oberfläche kognitiver oder metaphysischer Theorien, ohne so tief ins eigene Wesen vorzudringen, dass eine echte Transformation stattfindet.
Die reale Gefahr, beim Erwerb bloßen Wissens die eigentliche Erfahrung, auf die es abzielen soll, aus den Augen zu verlieren, hat nicht wenige Sucher dazu gebracht, den Wert des intellektuellen Durchdringens spiritueller Themen ganz zu verneinen. Da der Versuch kontemplativer Durchdringung leicht in intellektuelle Spekulationen ausarten kann, die unter Mitwirkung blumiger Begriffe wortreiche Vorstellungsbilder hervorbringen, ist die Skepsis nicht unbegründet. So beharrt so mancher Vertreter der Zen-Tradition darauf, dass lesen, denken, argumentieren und überlegen nichts nützt und nur blankes Meditieren in korrekter Körperhaltung zählt. Trotzdem schreiben auch solche Leute Bücher, in denen mehr steht als der Satz: Sitz und betrachte! Deshalb sei hier vorgeschlagen: Wenn man die Praxis vor lauter Theorie nicht vergisst, ist die intellektuelle Beschäftigung mit dem Thema nicht schädlich.
Wir greifen den Gedanken auf: Das normale Bewusstsein, nämlich das eines Ichs im egozentrischen Modus, ist überwertig damit beschäftigt, zum Vorteil der Person zu handeln. Es tut das, weil es der Person, mit der es sich gleichsetzt, so viel Bedeutung beimisst, dass die ständige Fokussierung ihrer Interessen folgerichtig erscheint. Was liegt also näher als die Bindung des Ichs an sein egozentrisches Treiben durch einen Frontalangriff zu brechen. Statt eigennützig zu handeln, kann man willentlich das Gegenläufige tun, also selbstlos handeln. Durch eine entsprechende Brute-Force-Attacke auf das egozentrische Muster müsste die Befreiung aus der Enge der Person in die Weite ihrer selbst zu erzwingen sein. Möglicherweise ist sie das. Aber keineswegs so zuverlässig, als dass programmatisch praktizierter Altruismus systematisch in einen Zustand wahrer Befreiung führen würde.
Zwickmühle
Wer aus sich einen besseren Menschen machen will, verfolgt ein persönliches Interesse: nämlich besser zu werden. Wer der Qualität seiner Person Bedeutung zumisst, hat sich bereits mit ihr identifiziert. Dadurch wird die Desidentifikation vom relativen Selbst behindert. Statt gezielt selbstlos zu handeln, genügt es zu beobachten, ob man es tut oder nicht.
Der Grund dafür ist leicht einzusehen. Selbstlosigkeit wird kaum je bereits dadurch verwirklicht, dass man für andere verzichtbereit Gutes tut. Für andere Gutes zu tun, ist, ungeachtet eines religiösen Vorsatzes, zum einen ein soziales Geschäft, zum anderen ein psychologischer Schachzug, der das Selbstwertgefühl ins Plus bringt, das Gewissen beruhigt und dadurch Schuldängste mindert.
Verdeckt verfolgt der Altruist hinter der Oberfläche seines Handelns eigennützige Ziele; und sei es nur das, mit Hilfe seiner Selbstlosigkeit sein kleines Selbst gegen das große einzutauschen.
Tatsächlich ist es oft aber noch verzwickter: Selbstloses Handeln bringt soziale Anerkennung ein. Man macht sich beliebt, vermeidet unangenehme Konflikte und pflegt mit vertretbarem Aufwand ein Selbstbild, auf das man stolz sein kann. Mit dem Stolz auf Qualitäten der eigenen Person wird jede ernsthafte Bereitschaft vereitelt, sie hinter sich zu lassen. Ein Tunichtgut, der nichts Besonderes auf sich hält, hat womöglich größere Chancen, ein spontanes Erleuchtungserlebnis zu erfahren, als jemand, der sich durch Tugend zum Vorbild anderer zu machen versucht.
Trotzdem: Solange man der Fallstricke programmatischer Tugend eingedenk ist, ist die Bereitschaft, uneigennützig zu handeln, eine nützliche Übung, um die Bindung an sein Ego behutsam zu lockern. Uneigennützig im vollgültigen Sinn kann aber nur handeln, wem jeder Gewinn daraus gleichgültig ist.
Während das selbstlose Handeln, nennen wir es gemeinsam mit den Hindus einmal Karma-Yoga, aktiv den Vorteil anderer ins Auge fasst, ist die bloße Hingabe, also Bhakti-Yoga, blanker Verzicht auf egozentrische Eigennützigkeit. Zu den Werkzeugen der Hingabe gehören Lobpreisungen Gottes, die Wiederholung von Gottesnamen, Gebetslitaneien und Mantras oder die kreisenden Tänze der Derwische. All das hat den Zweck, das Bewusstsein derart mit geistigen Akten der Hingabe ans Absolute zu füllen, dass für egozentrische Inhalte kein Platz mehr ist.
Drei Seiten der Medaille
| Wissen Jnana |
Handeln Karma |
Akzeptanz Bhakti |
| Ich versuche, Vorstellungen zu entwickeln, die so transparent sind, dass die Wirklichkeit hindurch erkennbar wird. | Ich versuche Gutes, also Passendes zu tun, das meiner Einbindung ins Ganze entspricht. | Ich nehme jede Erfahrung ohne Widerstand an. |
Auch die Praxis der Hingabe zielt darauf ab, die Identifikation des Ich mit dem Ego zu lösen. Nicht selten kommt es im Rahmen der Hingabe zu seelischen Erfahrungen, die als Gottesnähe oder gar -präsenz empfunden werden.
Hingabe und Konfessionalität
Konfessionalität als politisches Ordnungsprinzip der Gesellschaft hat im Grundsatz spaltende Wirkung. Sie festigt dualistische Denkmuster. Ihre hierarchische Struktur entmutigt oder bekämpft monistische Erfahrungen mystischer Einheit.
Nicht jeder, der sich einer Konfession verschreibt, hat aber politische Ziele. Im guten Glauben, dass eine bestimmte Konfession dazu den einzig richtigen Weg vorgibt, sind Millionen in Klöster eingetreten, um dort eine Verbindung zum Absoluten zu suchen. Oder aber sie geben sich ihrem Glauben hin, indem sie ihn zur alles bestimmenden Macht ihres Alltags ernennen. Beide Formen sind bereits Akte der Hingabe und können damit auch den Weg zu mystischen Erfahrungen bahnen.
Ins Kloster zu gehen, ist ein Akt der Entsagung von den weltlichen Dingen, mit denen sich die normale Person unentwegt befasst. Ein Leben nach Regeln, die keineswegs zu hinterfragen sind, ist ein Verzicht auf eigenes Meinen. Indem der Vorsatz des blinden Glaubens den persönlichen Verstand entmündigt, kann er Entwicklungen Vorschub leisten, die schließlich in die mystische Erfahrung überleiten. Der logische Widersinn, der konfessionelle Glaubensformen durchsetzt, ermutigt dazu, vom Verstand keine Zustimmung mehr zu erwarten, sondern sich den Routinen der Glaubenspraxis hinzugeben.
1 Korinther 1, 21:*
... gefiel es Gott, durch die Torheit der Heilsbotschaft die zu retten, die glauben...
Konfessionalität ohne politische Absicht kann als Weg des Bhakti-Yogas beschritten werden, wenn es zuletzt gelingt, die dualistische Setzung, die sie eigentlich vorschreibt, zu überschreiten. Meister Eckart war das gelungen.
Die praktische Umsetzung der Hingabe im Alltagsleben besteht darin, alle Erfahrungen, die das Leben anbietet, ohne Widerstand zu akzeptieren. Im christlichen Kulturkreis entspricht das dem Dein Wille geschehe... des Vaterunsers.
Eigentlich ist die mystische Erfahrung ein Akt des Verstehens. Etwas wird verstanden, indem man den Standpunkt der Betrachtung von hier nach da verschiebt. Das ist das Grundprinzip des Verstehens an sich.
Wenn die mystische Erkenntnis jedoch ein Akt des Verstehens ist, wie kann es dann sein, dass ihr der Verstand im Wege stehen kann; so wie es immer wieder von spirituellen Traditionen betont wird? Um das zu verstehen, muss man den Verstand genauer betrachten. Dabei macht es Sinn, zwei Varianten des Verstehens aufzuzeigen:
Der Verstand verschiebt den Standpunkt der Betrachtung. Dadurch geht er auf Abstand zum Betrachteten und befreit den Verstehenden aus dem Zugriff des Verstandenen.
Der dualistische Verstand rückt von der Welt ab und betrachtet deren duale Gegensätze:
Indem er die Gegensätzlichkeit der Welt erkennt, verfestigt er zweierlei Vorstellungen.
Indem der dualistische Verstand die Gegensätze erkennt ohne sie als zusammenhängende, sich wechselseitig bedingende und aufeinander einwirkende Polaritäten zu sehen, legt er sich auf die Vorstellung fest, als Person separat in der Welt zu existieren und dazu beauftragt zu sein, diese Existenz mit allen Mitteln gegen jede Infragestellung durch das Nicht-Ich zu verteidigen. Indem der dualistische Verstand die Wirklichkeit in Gegensatzpaare aufteilt, von denen jeweils ein Pol gilt, aber nicht beide zugleich, erschafft er sich eine Landkarte der Wirklichkeit, die ihm grobes Manövrieren ermöglicht.
Da das grobe Navigationssystem nur einen Fahrstil ermöglicht, der allenthalben Bordsteinkanten übersieht und an Bäumen vorbeischrammt, hat das dualistische Weltbild eine Menge Leid im Gefolge. Es ist das Leid, von dem Buddha sagt, dass man es beseitigen kann.
Der monistische oder mystische Verstand rückt nicht von der Welt ab und in die Person hinein, sondern aus der Person hinaus. Ihm wird es möglich, nicht nur die Gegensätzlichkeit der Pole zu erkennen, sondern auch ihren gemeinsamen Nenner. Für den monistischen Verstand ist Ich Ich, aber auch Du, was dem dualistischen als Unsinn erscheint.
Wenn in der Überschrift von einem Scheiternlassen des Verstandes die Rede ist, ist damit das dualistische Verstehen gemeint. Deshalb ist der Verstand an sich auch kein Fallstrick der Erleuchtung und es gibt keinen Grund ihn zwecks religiöser Erfüllung abzuschalten. Nützlich ist es allerdings einzusehen, dass der dualistische Verstand an den wesentlichen Fragen der Selbstfindung scheitert.
Der Zen-Buddhismus bedient sich zur Demonstration der Unzulänglichkeit des dualistischen Verstandes sogenannter Kōans. Dabei handelt es sich um paradoxe Fragen, die mit der üblichen Logik des Entweder-oders nicht zu beantworten sind. Indem der Übende seinen Verstand beim Versuch, die Nuss zu knacken, zermürbt, soll der Verstand aus dem dualistischen Modus des Erkennens in den mystischen freigesetzt werden. Ein bekanntes Beispiel ist die Frage: Wie hört sich das Klatschen einer Hand an?
Wer die Wirklichkeit zu verstehen versucht, ist auf künstlich konstruierte Fragen, an denen der dualistische Verstand an seine Grenzen stößt, nicht angewiesen. Es finden sich genügend ganz reale:
Das sind ganz konkrete Fragen der Kosmologie, die der Himmel uns als natürliche Kōans zur Verfügung stellt.
Das normale, also das egozentrische Ich sagt: Ich esse den Apfel. Es geht davon aus, dass es als die Person, die den Apfel isst, die zentrale Instanz in seinem Leben ist, die dieses Leben koordiniert, steuert und in eine Mitte zentriert. Diese Sichtweise hat so viel für sich, dass man sich kaum je klarmacht, dass es eine Alternative dazu gibt, deren Stichhaltigkeit ebenso wenig zu widerlegen ist.
Die alternative Sichtweise verhält sich zur üblichen wie ein Spiegelbild. Ihr gemäß entscheide nicht ich, den Apfel zu essen, sondern ich bin das Werkzeug einer Wirklichkeit, die sich in Äpfeln einen Ausdruck verschafft, zu dessen Wesen das Verzehrtwerden gehört. Damit das Wesen der Frucht in Erfüllung geht, bedarf es entsprechender Apfelesser, die dann meinen, sie selbst hätten sich in freiem Entschluss zum Apfelessen entschieden. In Wirklichkeit wurden ihre Bedürfnisse, Kauwerkzeuge, Zungen und Gelüste jedoch von der Evolution so angeordnet, dass sie bei passender Gelegenheit vom Impuls gesteuert werden, einen Apfel zu essen.
Keine Person hat sich je selbst erschaffen. Jede ist das Werk von Kräften, die ihr auch als Nicht-Ich polar gegenüberstehen. Diese Kräfte haben die Person so konstruiert, dass sie meist tut, was die Bedingungen des Nicht-Ich erfüllt. Ohne sich einzugestehen, dass man im Leben nicht nur Entscheidungen trifft, sondern auch dazu bestimmt ist, sie zu treffen, kann man sich nicht aus der überwertigen Bindung ans relative Selbst befreien.
Die Welt ist der Teil von mir, über den ich nicht frei bestimmen kann. Ohne dass ich verstehe, dass sie mich dazu bringt, sie haben zu wollen, kann ich nicht wissen, was ich wirklich bin.
Besitzverhältnisse
Es ist ein Segen, dass man vielerorts verstanden hat, dass der Einzelne keinem anderen gehören kann. Sklaverei und Leibeigenschaft haben keine Lobby mehr, die sie unverblümt als legitime Bausteine gesellschaftlicher Strukturen preisen. Nur hinter der Maske autoritärer Staatlichkeit, die sich als Ordnungsprinzip für unverzichtbar erklärt, hat sich der Herrschaftsgeist bewahrt.Der moderne Mensch glaubt nun, er gehöre keinem Herrn mehr, sondern sich selbst. Dabei begeht er einen Irrtum, der ihm in der Folge Probleme macht. Er glaubt, beim Selbst, dem er gehört, handele es sich um das relative Selbst. Er glaubt, die Person, als die er auf der Bühne des Lebens Rollen spielt, gehöre unmittelbar ihm. Dabei betrachtet er sich als autonome Instanz, die dem Rest der Welt mit dem Anspruch begegnet, über sich selbst zu bestimmen.
Tatsächlich gehört die Person aber der Welt und erst durch die Welt hindurch sich selbst. Beim Selbst, dem der Mensch tatsächlich gehört, handelt es sich nicht um das relative, sondern um das absolute Selbst.
Deshalb gilt zweierlei:
Im Bezug zu anderen Personen ist es folgerichtig, sich gegen Besitzansprüche von außen zu verwahren.
Auf der sozialen Ebene ist die Person Besitzerin ihrer selbst. Auf der existenziellen Ebene gehört sich die Person nur, wenn sie sich der Welt nicht zu entziehen versucht. Aufgaben, die sie in der Welt zu lösen hat, werden ihr von der Welt diktiert.
Kern der Erleuchtung ist die Preisgabe der persönlichen Identifikation zu Gunsten der überpersönlichen Identität. Was wird dann aber aus der Freiheit? Kann das Individuum freie Entscheidungen treffen? Oder ist es das Werkzeug einer überpersönlichen Kraft, die über es bestimmt?
Eine sinnvolle Antwort auf diese Frage scheitert am Entweder-oder. Zu meinen, nur das eine oder das andere könne wahr sein, beruht auf dem dualistischen Vorurteil des egozentrischen Denkens. Das egozentrische Ich denkt:
Tatsächlich ist Gott aber das, was sein Wesen erfüllt, indem es frei ist. Das absolute Selbst steht daher als Prinzip des Sowohl-als-auch über den bloßen Gegensätzen. So wie das Elektron zugleich Welle und Teil ist, ist das Ich zugleich frei und bestimmt. Indem es als Bewusstheit das Licht des Absoluten zur Erscheinung bringt, ist es zur Freiheit bestimmt.
Freier Wille ist Bewusstheit selbst. Je bewusster das Ich, desto freier ist es. Wird es seiner selbst nicht bewusst, wird es durch Automatismen gesteuert, die im Laufe der Evolution und der Biographie als Vorgaben angelegt wurden. Indem das Ich die Vorgaben erkennt, die seine Person ausmachen, befreit es sich zu sich selbst.
In der Regel werden Kutten als Zeichen der Unterwerfung unter den Willen einer göttlichen Allmacht betrachtet. Dieser Ansatz entspringt einem dualistischen Gottesbild, und damit einem Gottesbild, das der egozentrischen Deutung der Wirklichkeit verhaftet bleibt.
Aus der Sicht des Egos ist Gott eine Allmacht, die verlangt, dass sich ein jeder ihren Befehlen beugt. Macht ist die Möglichkeit über etwas anderes zu bestimmen. Da die dualistische Sicht davon ausgeht, dass zwischen Schöpfer und Geschöpf ein kategorischer Graben liegt, der den Menschen zu dem anderen macht, über das Gott dann bestimmen will, stellt ihr Gottesbild die Allmacht als primäres Attribut des Göttlichen in den Vordergrund.
Aus mystischer Sicht steht die Freiheit über der Macht, denn um Macht zu haben, bedarf es der Freiheit, sie zu ergreifen. Freiheit ist etwas anderes als Macht. Während Macht über anderes bestimmt, bestimmt Freiheit sich selbst. Gott kann allmächtig sein, wenn er sich dazu herablässt. Aber tut er das? Oder verschenkt er sein höheres Wesen - Freiheit - an die, die bereit sind, sie selbst zu sein?
Aus mystischer Sicht macht es keinen Sinn, sich Gott zu unterwerfen, weil ihn die Unterwerfung in der Vorstellung des Unterworfenen von der Freiheit zur Macht degradiert. Statt Gott in seiner ganzen Größe zu erkennen, vergrößert sich der Unterworfene selbst, indem er dem Akt seiner Unterwerfung eine Bedeutung für Gott beimisst. Aber nur der, der seiner Person keine Bedeutung mehr gibt, anerkennt, was sie hervorbringt. Kutten sind daher nicht schlecht. Besser aber man nutzt sie nicht, um sich irgendwem zu unterwerfen, sondern um sich aus der Enge der bloßen Person zu befreien.
Die Antwort auf die Frage, ob der Mensch einen freien Willen hat oder ob er als bloßes Objekt von Kräften gesteuert wird, die die einen als Gott bezeichnen, die anderen als Summe physikalischer Gesetze, hängt von der Perspektive ab, von der aus sie gegeben wird. Als bloße Person müsste der Mensch ehrlicherweise sagen, dass er keinen freien Willen hat und dass alles, was er entscheidet, Resultat von Reiz-Reaktions-Automatismen ist, deren Ursprung sich im Geheimnis göttlicher Willkür oder den Zufällen der Quantenmechanik verliert. Als er selbst hat der Mensch aber das Recht, einen freien Willen für sich in Anspruch zu nehmen, da sein wahres Selbst das ist, was ihn verwirklicht und ihm von seiner Freiheit das Stück verliehen hat, das ihm zukommt.
Berichte über sogenannte Nahtoderfahrungen häufen sich. Ursache sind Fortschritte der Notfallmedizin. Durch deren Einsatz wird es möglich, Menschen von der Schwelle des Todes zurückzuholen. Bei der Nahtoderfahrung wird die Perspektive nicht durch bewusste Einsicht verändert. Sie geschieht dem Betroffenen. Trotzdem kann auch sie als alternative Sichtweise auf die Wirklichkeit bezeichnet werden.
Nahtoderfahrungen werden typischerweise an Unfallorten, in Operationssälen oder auf Intensivstationen gemacht, also überall dort, wo der Tod fast schon eingetreten ist, wo es durch Maßnahmen der Reanimation aber gelingt, die Unumkehrbarkeit abzuwenden, sodass es den Geretteten möglich wird, Erfahrungen zu beschreiben, die sie an der kritischen Schwelle machten.
Typischerweise wird dabei über dreierlei berichtet:
Statt im Körper zentriert zu sein, löst sich das Ich bei der Nahtoderfahrung vom Körper ab und betrachtet die Szenerie aus einer erhöhten Position. Von dort aus nimmt es den Ablauf der Ereignisse wahr. Es sieht zu, wie die Retter versuchen, den Körper wiederzubeleben.
Im Gegensatz zur mystischen Erfahrung bleibt die Identifikation mit der eigenen Person bestehen. Der Erfahrende erlebt sich weiterhin als separates Subjekt, das aus einer topografisch verschobenen Position heraus beobachtet, was andere Personen machen. Das Licht und der Tunnel, der zum Licht führt, werden als gegenüberstehende Objekte erfahren. Genauso ist es mit den transzendenten Personen. Auch sie bleiben für den Erfahrenden Objekte, die er als etwas anderes als sich selbst betrachtet.
Wie mystische können auch Nahtoderfahrungen zu tiefgreifenden Persönlichkeitsveränderungen führen. Das ist zwei Ursachen zuzuschreiben:
Die schiere Tatsache, dem Tod nah gewesen zu sein, führt dem Betroffenen die Endlichkeit des irdischen Daseins vor Augen. In der Folge ändert er die Prioritäten im Leben. Unwesentliches wird uninteressant. Die Frage nach dem Wesentlichen rückt in den Vordergrund.
Beides zusammen führt dazu, dass der Bezug des Erfahrenden zur Wirklichkeit fortan religiös bzw. spirituell wird.
Worauf schauen Sie jetzt? Auf einen Monitor, ein Tablet, ein Smartphone, ein Buch? Wie auch immer. Was ist das, worauf Sie schauen? Ein Objekt. Richtig. Was aber, wenn man das Objekt in seine Einzelteile zerlegt? Dann spricht man von vielen Objekten: Elektroden, Platinen, Schräubchen, Kabeln, Steckern, Buchseiten. Und wenn man es in seine Atome aufspaltet? Dann hat man Myriaden von Objekten vor sich.
Die normale Sichtweise auf die Wirklichkeit geht davon aus, dass die Welt aus Myriaden von Objekten besteht und dass deren belebten Varianten jeweils ein eigenes Subjekt zukommt.
Die mystische Sichtweise glaubt nicht an mehrere Subjekte. Sie betrachtet alles Subjektive als Ausdruck eines einzigen Subjekts.
Welche Konsequenz ergibt sich aber aus der mystischen Sichtweise für die Zahl der Objekte? Besteht die materielle Komponente des Universums aus Myriaden von Objekten oder ist es stimmiger, sie als ein einziges Objekt aufzufassen, das dem einzigen Subjekt komplementär erscheint?
Wer die spirituelle Selbstverwirklichung zum Ziel hat, tut gut daran, die objektive Welt als ein einziges Objekt zu betrachten, als ein kosmisches Uhrwerk zu dem jede Person so gehört wie jedes Blatt zu seinem Baum. Die Einzigartigkeit des Selbst ist besser zu verstehen, wenn man darauf verzichtet, einzelne Objekte als eigenständig anzusehen.
Seien Sie konsequent. Betrachten Sie es so:
Veränderte Sichtweisen auf die Wirklichkeit können auch durch organische bzw. toxische Einflüsse auf das Bewusstsein vermittelt werden. Zu nennen sind:
Zwischen mystischen und spirituellen Erfahrungen einerseits sowie organisch bzw. toxisch verursachten andererseits gibt es Überlappungen.
Zu den psychotropen Substanzen, die alternative Sichtweisen auf die Wirklichkeit vermitteln, gehören vor allem Psychedelika (griechisch psyche [ψυχη] = Seele und delos [δηλος] = offenbar) bzw. Halluzinogene. Gelegentlich werden sie als Entheogene bezeichnet, also als Substanzen, die Gotteserfahrungen bewirken. Solche Substanzen können zu beeindruckenden Veränderungen des Welt- und Selbsterlebens führen. Vor allem in schamanistisch geprägten Kulturen (z.B. der Native American Church) wurden und werden sie daher zur Induktion ritueller Trancezustände eingesetzt.
Es ist davon auszugehen, dass psychedelische Bewusstseinszustände gegebenenfalls Persönlichkeitsentwicklungen auslösen können, die jenen entsprechen, die von autonomen mystischen Erfahrungen bekannt sind. Zu glauben, man müsse nur entsprechende Substanzen konsumieren, um spirituelle Befreiung zu erzielen, ist jedoch naiv. Die Grenze zwischen bereichernder Erfahrung und Missbrauch zu psychologischen Zwecken profaner Art ist fließend. Außerdem ist der Konsum mit der Gefahr belastet, schwere psychiatrische Komplikationen auszulösen (z.B. Angstzustände, protrahierte Psychosen und Depersonalisationssyndrome). Daher überrascht es nicht, dass sich die buddhistische Tradition ausdrücklich gegen den Konsum psychotroper Substanzen ausspricht.
Was das eine vom anderen unterscheidet, ist nicht die Substanzwirkung an sich, sondern das, was der Anwender aus der Erfahrung macht. Die Erfahrung kann eine Initialzündung sein, die zu einem autonomen Bemühen um eine spirituelle Reifung der Persönlichkeit führt. Oder sie bleibt ein vorübergehender Ausnahmezustand, der den Konsumenten für ein paar Stunden aus einer Realität entführt, die seinen Ansprüchen nicht genügt.
Ein einfaches Kriterium kann dazu dienen, das erste vom zweiten zu unterscheiden. Führt die Anwendung zu einer spirituellen Entwicklung, wird sie nicht oder nur selten wiederholt... und schließlich aufgegeben; denn dem spirituell reifen Menschen gelingt es, mit der Wirklichkeit so übereinzustimmen, dass ihm psychedelisch induzierte Bewusstseinsveränderungen überflüssig erscheinen. Wird die Substanz im Gegensatz dazu immer wieder konsumiert, zeigt das an, dass sie keine spirituelle Entwicklung auslöst.In früheren Zeiten hat man die Epilepsie auch als Morbus sacer (= heilige Krankheit) bezeichnet. Offensichtlich ging man davon aus, dass die Betroffenen von transzendenten Kräften ergriffen werden; seien diese nun göttlicher oder dämonischer Art. Als besondere Spielart der Epilepsie sind die psychomotorischen Anfälle zu nennen. Dabei kommt es nicht zum Bewusstseinsverlust, wie bei der Grand-Mal-Epilepsie, sondern zu veränderten Bewusstseinszuständen. Zum typischen Spektrum der epileptischen Erlebnisse gehören (Poeck, Klaus: Neurologie, Springer):
Derartige Bewusstseinsveränderungen können von Betroffenen als spirituelle Erfahrungen gedeutet werden und in der Konsequenz zu einer betonten Hinwendung zu religiösen Themen führen. Ein Beispiel mögen die Trancezustände Ramakrishnas sein, deren spezifischer Ablauf an eine epileptische Genese denken lässt.
Alternative Erfahrungen im Überblick
| mystisch | Nahtod | psychedelisch | epileptisch |
| monistisch Überschreitung der Subjekt-Objekt-Grenze |
dualistisch Einhaltung der Subjekt-Objekt-Grenze |
||
| Wahrnehmung aus existenziell verschobener Perspektive | Wahrnehmung aus topographisch verschobener Position | Veränderte Wahrnehmung sinnlich erfahrbarer Eigenschaften von Objekten, einschließlich des Körpers | |
| Keine Wahrnehmung zusätzlicher Objekte | Wahrnehmung zusätzlicher Objekte | ||
Die zusätzlichen Objekte, die gegebenenfalls wahrgenommen werden, werden ja nach Weltbild des Betrachters entweder als Halluzinationen, also Trugwahrnehmungen gedeutet, oder als Visionen transzendenter Personen oder Strukturen.
Das Leben als Teil einer Menschheit, der man körperlich ausgesetzt ist, liefert eine Menge Argumente dafür, den dualistischen Graben zwischen Ich und Nicht-Ich nicht allzu gründlich aufzugeben. Die mystische Erfahrung macht deutlich, dass der Graben nur auf der Ebene des dualistischen Erfahrungsfeldes existiert, vor dessen Ursprung aber nicht. Als absolutes Selbst sind Subjekt und Objekt eins. Das schafft eine Nähe, in der dem Ego mulmig wird. Grund genug, Erleuchtung nicht ernsthaft anzustreben. Grund genug, sich bloß vorzugaukeln, dass man es tut. Kurzum: Das größte Hindernis, das mystische Erfahrungen verhindert, ist genau das, was sie zu überschreiten versucht: die Egozentrizität.
Zu den Hindernissen ist auch der Zeitgeist zu rechnen. Wir leben in einer Kultur, die die religiöse Dimension der Existenz wenig beachtet und stattdessen davon ausgeht, dass aller Wert des Menschenlebens im Diesseits auszuschöpfen ist... oder eben nie. Da es unserer Kulturform gelungen ist, Zahl und Ausmaß weltlicher Verlockungen beträchtlich zu erhöhen sowie Medien einzurichten, die deren Reize jedem vor Augen führen, geht von ihr eine hypnotische Suggestionskraft aus, der man sich nur schwer entziehen kann.
Die Hindernisse sind jedoch verzwickter. Selbst wenn man ernsthaft zur Sache geht und sich womöglich mit aller Kraft dem erstrebten Ziel verschreibt, ist der Erfolg keineswegs sicher. Nicht umsonst meinen buddhistische Autoren, dass man gegebenenfalls mehrere Leben braucht, um das sogenannte Nirvana zu erreichen; eine Vorstellung, die nur Sinn macht, wenn man von der Wiedergeburt persönlicher Entitäten ausgeht, deren Existenz der Buddhismus im gleichen Zuge verneint.
Zu den speziellen Hindernissen, auf die der Sucher trifft, zählen, neben der Fehleinschätzung der eigenen Bedeutung, Ehrgeiz und Stolz; aber auch ein Gerechtigkeitsgefühl, das eher Ansprüche erhebt, als Ansprüche zu erfüllen.
Erleuchtung ist ein Ziel, das aus der Person heraus formuliert wird. Die Person geht davon aus, dass es jenseits ihrer Alltagserfahrung eine Wirklichkeit zu entdecken gibt, deren Entdeckung größte Vorteile verheißt: Frieden, Stille, Befreiung vom Leid oder gar Ananda (Sanskrit आनन्द), also die schiere Glückseligkeit, von der der Hinduismus spricht.
Mobilisiert die Person des Suchers nun all ihre Kräfte um das Ziel zu erreichen, mobilisiert sie zugleich die Person selbst. Die Person macht sich für das Ziel stark, sich selbst zu überwinden. Das Paradoxe daran ist offensichtlich. Je mehr ihrer Kraft die Person mobilisiert, desto schwerer fällt es ihr, von sich abzulassen. Je höher das Ziel ist, für dessen Erreichen sich die Person einsetzt, desto mehr Bedeutung schreibt sie sich zu. Je mehr Bedeutung ihr als treibende Kraft auf dem Weg zur Erleuchtung zukommt, desto unentbehrlicher wird sie.
Der ausdrückliche Vorsatz ist ein Grund dafür, warum viele Menschen spontane mystische Erfahrungen machen, es ihnen aber partout nicht gelingen will, sie zu wiederholen oder gar zu vertiefen. Der Vorsatz kann seiner Erfüllung im Wege stehen. Je stärker der Vorsatz, desto mehr versetzt der Sucher seinen Fokus vor sich statt in sich.
Zwillingsbruder
Ein Zwillingsbruder des Ehrgeizes ist das Geltungsbedürfnis. Es entspringt unmittelbar der egozentrischen Sichtweise. Da sich das Ich durch sein egozentrisches Selbstbild in den Horizont seiner Person verkleinert, versucht es prompt als groß zu gelten. Man gilt vor allem etwas in den Augen anderer. Zwei Varianten sind üblich:
Man versucht, anderen durch vorauseilende Gaben oder große Taten zu gefallen, damit man in ihren Augen als etwas Besonderes gilt. Man macht andere auf sich aufmerksam und denkt: Was bemerkt wird, muss Bedeutung haben.
Nur wenige sagen: Was andere von mir denken, ist unwichtig, weil ich es bin. Wer das erkennt, ist auf dem rechten Weg.
Viele, die nach Erleuchtung streben, nehmen erhebliche Mühen in Kauf. Erleuchtung ist Ihnen ein Ziel, das den Einsatz lohnt. Wer sich um etwas bemüht und dann Fortschritte zu verzeichnen hat, schreibt die Fortschritte seinem Einsatz zu. In der Folge droht er stolz auf das Erreichte zu sein. Stolz - wir ahnen es schon - ist eine der seelischen Regungen die uns fast mehr als jede andere in die Identifikation mit jener Person treibt, der die Verdienste zu verdanken sind. So kommt es, dass jeder Fortschritt auf dem Weg zum spirituellen Ziel, Hürden aufbauen kann, die ohne Fortschritt gar nicht da gewesen wären. Der Erfolg steigt dem zu Kopfe, der eigentlich das Herz entdecken will.
Schlimmer noch: Fortschritte schüren nicht nur den Stolz, sie stacheln auch den Ehrgeiz an. Wer regelmäßig meditiert, ohne sichtlich vom Fleck zu kommen, glaubt nach einiger Zeit, dass das Ziel unerreichbar ist oder eine Illusion, die Leute in die Welt gesetzt haben, um sich wichtig zu machen. Kommt plötzlich ein Fortschritt zustande, ist der Hunger nach mehr schnell entfacht. Statt im Hier-und-Jetzt zu bleiben, gehen die Pferde durch als hätten sie nach langer Dürre frisches Gras gerochen. Prompt wird die Meditationsuhr von 20 auf 40 Minuten gestellt. Bald schmerzen Glieder und Rücken ohne dass das Gras in Sichtweite kommt.
Man erkennt nur, was man sieht. Was man nicht sieht, erkennt man nicht.
Da der Mensch den größten Teil des Universums nicht sieht, ist es ihm quasi unmöglich zu erkennen, wie wenig Bedeutung ihm zukommt. Daher schreibt sich die Person und allem, was sie unmittelbar betrifft, eine überwertige Bedeutung zu. Wer die Wirklichkeit ohne dieses Vorurteil erkennen will, muss die Fehleinschätzung überwinden. Dass ist schwer. Denn sobald das egozentrische Ich zu hören bekommt, dass es in Wirklichkeit quasi bedeutungslos ist, widerspricht es dem mit aller Kraft. Das ist sein Auftrag. Es soll ja als Anwalt der Person, deren Interessen vertreten und es kann das nur, wenn es sie wichtig nimmt.
Seine persönliche Bedeutungslosigkeit kann nur ohne Abstrich akzeptieren, wer zugleich in der Gewissheit lebt, im anderen Pol seines Wesens unendlich zu sein. Jeder andere mag zwar tapfer in die Kröte beißen, bei der nächsten Gelegenheit wird er aber versuchen, sie auszuspucken. Alles Manifestierte geht gegen Null, weil es als Unmanifestiertes gegen unendlich geht.
Das Gerechtigkeitsgefühl als Hindernis zu bezeichnen, ist problematisch. Kaum denkbar, dass Menschen ohne Gerechtigkeitsgefühl in der Lage sind, das zu verkörpern, was einer konsensfähigen Definition des Menschseins gerecht werden könnte. Wenn man so kühn ist, es an dieser Stelle trotzdem als ein Hindernis auf dem Weg zur Erleuchtung aufzufassen, muss das gut begründet sein.
Zwei Gesichter der Gerechtigkeit
Die Ungerechtigkeiten, die Menschen vor allem von Seiten anderer zu erdulden haben, sind so eklatant und abstoßend, dass die Preisgabe eines dualistischen Welt- und Gottesbildes schwerfällt. Wer wünscht sich nicht, dass es einen himmlischen Richter gibt, der Gut und Böse kategorisch unterscheidet und dereinst dementsprechend Lohn und Strafen vergibt? Gibt man das Konzept einer separaten Existenz des Einzelnen jedoch auf, kann man nur noch schwer erklären, über wem dieser Gott im Jenseits zu Gericht sitzt. Gegen das mystische Gottesverständnis könnte daher eingewendet werden, es stelle einen Freibrief für sämtliche Schandtaten aus, zu denen der Mensch fähig ist. Denn ist es nicht so: Wenn das absolute Selbst im Täter ebenso präsent wie im Opfer ist, dann müsste sich ein richtender Gott im Jenseits selbst dafür strafen, was er im Diesseits geschehen ließ.
Dazu Folgendes: Gerechtigkeit kann etwas sein, was man übt, oder etwas, was man erwiesen bekommt. Der Wunsch nach einem gerechten Ausgleich für erlittenes Unrecht auf Erden zielt auf eine Gerechtigkeit ab, die von außen zugeteilt wird. Der Wunsch ist legitim. Aber kann er viel bewirken? Gewiss hat die Angst vor der Strafe durch einen entrückten Gott schon viele von Missetaten abgehalten, die sie sonst begangen hätten. Doch Hand aufs Herz: Sind andererseits im Namen solcher Götter nicht schon so viele Verbrechen begangen worden, dass man kaum entscheiden kann, was überwiegt: die Zahl der verhinderten oder die Zahl der begangenen?
Das mystische Gottesbild appelliert nicht an eine Gerechtigkeit, die irgendwann und irgendwo erwiesen wird. Indem es vielmehr davon ausgeht, dass der Einzelne nicht nur ein mehr oder minder missratenes Werk Gottes ist, sondern dessen existenzielle Präsenz, gibt es allen Anlass, nicht nur Gerechtigkeit im Jenseits zu erhoffen, sondern sie hier und jetzt zu üben.
Mystische Erfahrungen können im Leben eines Menschen sehr viel verändern. Darüber, wie solche Veränderungen zustande kommen, neigen Autoren spiritueller Texte zu zwei komplementären Aussagen.
Die einen vertreten die Ansicht, die Veränderung komme ausschließlich durch ein singuläres Erweckungserlebnis zustande, dessen Wirkung dann irreversibel und kategorisch ist (z.B. Krishnamurti). Erleuchtung unterliegt in ihren Augen dem Alles-oder-nichts-Prinzip.
Es gibt nur wenig Grund, daran zu zweifeln, dass sowohl der langwierige Prozess als auch das spontane Erleuchtungserlebnis zu grundlegenden Veränderung der Persönlichkeit führen können. Andererseits beschreiben viele Menschen Erfahrungen, die offensichtlich mystischer Natur gewesen sind, deren Wirkung auf das weitere Erleben mit der Zeit jedoch weitgehend oder vollständig verblasst. Ob mystische Erfahrungen grundsätzlich zur Transformation führen ist also fraglich. Aus zwei Gründen rückt die spirituelle Arbeit am Bewusstsein daher in den Vordergrund.
Spontane Erfahrungen sind eben spontan. Eigentlich kann man nur abwarten, ob sie sich ereignen. Wer auf Transformation hofft, wird damit kaum zufrieden sein.
Glaube und Gewissheit
Das Besondere am eigentlichen Erleuchtungserlebnis ist, dass es den, der es erfährt, von einer grundsätzlich anderen Struktur der Wirklichkeit überzeugt. Es führt zu einer Gewissheit, die durch den bloßen Glauben daran, dass sie erreichbar ist, niemals ganz ersetzt werden kann. Trotzdem hat der Glaube an die Möglichkeit einer religiösen Befreiung große Bedeutung. Er motiviert dazu, vorbereitende Schritte zu tun, die selbst dann, wenn niemals eine Erfahrung eintritt, die die unumkehrbare Gewissheit bewirkt, eine heilsame Wirkung auf die Persönlichkeit ausüben können, die der Wirkung der Gewissheit zumindest ähnelt.
Die Wirkungen der Erleuchtung hängen mit deren Kernprozess zusammen. Der Erleuchtete versteht, dass er mehr ist als der private Gegensatz zu einer Welt, mit der er nicht mehr zu schaffen hat, als hineingeraten zu sein. Er versteht, dass er selbst das ist, dessen persönlicher Pol seine Person ist, dessen überpersönlicher Pol zugleich alles umfasst, was von der Person aus als Nicht-Ich erkennbar wird.
Zwei Formen der Freiheit
Die erste macht frei. Die zweite macht freier.
Was bewirkt Erleuchtung?
Freiheit
Was vermittelt sie nicht?
Übernatürliche Fähigkeiten
Anfängergeist
Da man nie weiß, ob hinter dem, was man erkennt, nicht etwas liegt, was man nicht erkennt, beantwortet man die Frage, ob man erleuchtet ist, am besten mit einem klaren Nein; egal ob man sich für erleuchtet hält oder nicht. Es geht nicht darum, das Ziel zu erreichen, sondern dorthin aufzubrechen.
Das spirituelle Verstehen, also die Verschiebung des Standpunkts, von wo aus der Erleuchtete auf die Wirklichkeit reagiert, führt spezifische Veränderungen seiner Persönlichkeit herbei. Dazu gehören folgende:
Da der Erleuchtete nicht mehr kategorisch zwischen Ich und Nicht-Ich unterscheidet, vermindert sich sein Interesse an Besitz, Konkurrenz, Rivalität, Status und sozialer Rolle. Die Welt ist in seinen Augen kein Gegenüber mehr, von dem man sich möglichst viel einverleiben sollte, sondern ein Mitspieler, der im Prozess der Selbstverwirklichung das Gegengewicht bildet, ohne das es den Prozess nicht gäbe. Statt sie als etwas zu sehen, das es zu erobern gilt, fasst er die Welt als Spektrum von Bedingungen auf, das von je her zum Leib seines eigenen Selbst gehört.
Der Erleuchtete akzeptiert die Wirklichkeit als sein Selbst. Dann schaut er, ob er als Person einen spezifischen Einfluss darauf haben kann und sollte. Er wirkt mehr indem er ist als indem er will. Für seine Person tut er das, was für sie notwendig ist. Er dient nicht ihrer Größe, sondern betrachtet sie als Mittel. Zugleich nimmt er sie an, wie sie ist.
In der Folge verhält sich der Erleuchtete anderen gegenüber wertschätzend und solidarisch. Sein Entgegenkommen ist dabei nicht psychologisch motiviert. Das heißt: Er kommt anderen nicht entgegen, weil er sie als Bündnispartner gewinnen will, weil er sie dazu bewegen will, ihn zu mögen oder weil er sich vor Konflikten fürchtet. Er kommt ihnen entgegen, weil er sich selbst in Ihnen erkennt. Die Nähe zum anderen ist für ihn kein Schachzug, durch die er sein Umfeld steuert, sondern Ausdruck der Art, wie er sich selbst versteht.
Da sich der Erleuchtete auch das Nicht-Ich zuordnet, reagiert er auf Ereignisse im Umfeld gelassen. Er verzichtet darauf, Ereignisse vor dem Hintergrund seines persönlichen Vorteilsdenkens als gut oder schlecht zu bewerten. Da er nicht mehr urteilt, teilt er Welt nicht mehr in zwei gegensätzliche Kategorien auf. In seinen Augen bedingen sich alle Ereignisse und Zustände wechselseitig. Sie sind interdependente Ausdrucksformen einer unteilbaren Wirklichkeit. Das gilt auch für andere Personen.
Der Erleuchtete ist in der Lage, selbst in Gegenständen eine Präsenz zu spüren, die sich vom bloßen Vorliegen eines Objekts unterscheidet. Er weiß, dass das Heilige grenzenlos ist und in der Folge auch alle Objekte durchdringt. Das kann seinen Umgang mit Objekten respektvoller machen. Der Erleuchtete geht davon aus, dass jedes Objekt jenen Wert repräsentiert, der über den Nutzwert für seinen Verwender hinausgeht. Die Art, wie er Gegenstände verwendet, gewinnt an Nachhaltigkeit.
Was Gegenständen gegenüber gilt, gilt erst Recht gegenüber allem Belebten. Der Erleuchtete betrachtet nicht nur Menschen, sondern auch Pflanzen und Tiere als besondere Ausdrucksformen des Absoluten, in denen ihm das Absolute mehr als in bloßen Objekten entgegenkommt.
* Die Heilige Schrift / Familienbibel / Altes und Neues Testament, Verlag des Borromäusvereins Bonn von 1966.
** Der Koran, (Komet-Verlag, ISBN 3-933366-64-X), Übersetzung von Lazarus Goldschmidt aus dem Jahr 1916.