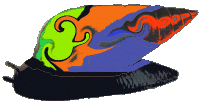
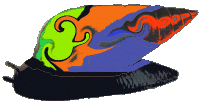
Das Ich entsteht, indem das Selbst als Person ins Dasein tritt. Als Person erfährt das Selbst ein Dasein, das an konkrete Bedingungen geknüpft und durch konkrete Horizonte begrenzt ist. Deshalb ist das Ich grundsätzlich interessiert.
Interesse setzt sich aus den lateinischen Begriffen inter = zwischen und esse = sein zusammen. Das Ich ist an den Sachverhalten interessiert, zwischen die es durch sein Da-Sein eingewoben ist, also durch die Festlegung des Ortes, an dem es erscheint. Jedem Da-Sein ist zugleich ein Zeitpunkt zugeordnet, zu dem es am entsprechenden Ort anwesend ist.
Interesse kommt dem zu, was zwischen anderem ist, sich von diesem anderen unterscheidet und durch anderes eingegrenzt wird. Durch spirituelle Meditation versucht sich das Ich selbst zu erfahren. Das eigentliche Hindernis, auf das es dabei stößt, ist sein Interesse an dem, was mit seinem Dasein als konkrete Person an einem konkreten Ort in der Raumzeit zusammenhängt. Die Themen dieses Daseins füllen sein Bewusstsein und verhindern so, dass das Ich seinen Blick auf die Wirklichkeit über sich hinaus erweitert. Das Ich kann sein Interesse an dem, was es persönlich betrifft, kaum hinter sich lassen, da das persönliche Ich mit dem Interesse an dem zusammenfällt, was es ausmacht. Das persönliche Ich ist eine Reduktion des Selbst auf das, was sich selektiv für sich interessiert.
Spirituell kann sich das Ich nur erfahren, wenn es versteht, dass es als persönliches Ich, also als Ego, nur eine Erscheinung ist, die einem Du oder Es begegnet, tatsächlich aber ein Selbst, das das Du und das Es ebenso umfasst wie beide ihm zugrunde liegen. Spirituelle Erkenntnis befreit aus der Enge des Egos. Aus dem Interesse an den Objekten wird ein Interesse für die Objekte.
Entwicklungspsychologie
Das Verhalten des Säuglings wird von zwei Mustern bestimmt:
Fisch- und Menschenfang
Milliarden Fische verlieren ihr Leben, weil sie Menschen in die Falle gehen. Milliarden Menschen verlieren ihre Freiheit, weil sie handeln wie Fische. Vier Mechanismen werden Fischen zum Verhängnis:Mechanismen, die Fischen das Leben rauben, rauben Menschen die Freiheit, sie selbst zu sein.
Beobachtet man den Inhalt des Bewusstseins, erkennt man verschiedene Elemente, die miteinander verknüpft sind:
Sensorische Wahrnehmungen informieren über Zustände der Außenwelt oder den Funktionszustand des Körpers.
Gedanken beurteilen Qualität, Nutzwert und Gefahrenpotenzial des Wahrgenommenen oder sie entwerfen Modelle der Wirklichkeit; z. B. in Form phantasierter Dialoge bzw. vorgestellter Handlungsabläufe. Ihr Fokus kann auf persönliche Belange ausgerichtet sein oder auf die überpersönliche Struktur der Wirklichkeit.
Gefühle und Stimmungen bewerten die Wirklichkeit, gemäß dem Bild, das sich der Geist zum Zeitpunkt der Bewertung von ihr macht.
Impulse drängen dazu, Handlungen auszuführen, die in die Wirklichkeit eingreifen. Impulsen gehen bewusste oder unbewusste Urteile voraus. Sie können ihrerseits beurteilt werden.
Urteile sind Bewertungen, die die Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle und Impulse gemäß den Kategorien richtig oder falsch, gut oder schlecht bzw. gut oder böse einordnen. Urteile führen zu Meinungen über die Struktur der Wirklichkeit. Meinungen sind Konstrukte verschachtelter Urteile, die sich untereinander bedingen.
Erinnerungen sind bildhafte Darstellungen vergangener Erlebnisse. Sie entsprechen nicht 1:1 den tatsächlichen Ereignissen, sondern sind subjektiv mehr oder weniger stark überarbeitet.
Gedanken, sind vorübergehende Vorstellungen, die sich in immer neuen Varianten wiederholen und thematisch meist auf die Belange der eigenen Person verengt sind. Den Gedanken sind Gefühlsqualitäten zugeordnet, die das grundsätzliche Verhalten der Person durch Impulse, die der Gefühlsqualität entsprechen, in der Welt ausrichten.
Gefühl und Impuls
Im Modus des normalen Daseinsvollzugs wird das Bewusstsein durch eine kontinuierliche, ineinander verflochtene Abfolge von sensorischen Wahrnehmungen, Gedanken, Bewertungen, Gefühlen, Stimmungen und Impulsen ausgefüllt, die das Ich als unmittelbare Darstellung der Wirklichkeit deutet. Tatsächlich ist die Abfolge der Bewusstseinsinhalte aber ein Film, der aus flüchtigen Impressionen besteht. Er ist eine Wirklichkeitsdeutung und nicht die Wirklichkeit selbst. Als Hypothese steuert er die Person analog durch die Situationen, die sie zum jeweiligen Zeitpunkt durchquert.
Diese Steuerung funktioniert weitgehend automatisch. Die Entscheidungsprozesse, die dabei anfallen, werden nicht bewusst reflektiert, sondern anhand von Mustern vollzogen, die Ergebnis bisheriger Erfahrungen und daraus abgeleiteter Urteile sind. Nicht mehr reflektierte Urteile werden als Vorurteile bei der weiteren Realitätsdeutung als wahr vorausgesetzt. Sie erscheinen als selbstverständlich. Das heißt: Das Ich definiert sich auf Grund vermeintlich selbstverständlicher Urteile, deren Wahrheitsgehalt es nicht weiter prüft.
Zu den Vorurteilen der normalen Realitätsdeutung gehört die Hypothese: Ich befinde mich als Teil in der Welt und erfahre sie von dort aus. Der spirituelle Mensch stellt diese Annahme in Frage. Er überprüft sie. Er geht zu dem, was er bislang als sein Ich aufgefasst hat, auf Distanz und beobachtet von da aus. Er untersucht das Erkennbare, um sich in eine Position zu entbinden, von der aus er das Ich als das erkennen kann, was es tatsächlich ist: Konzept, Hypothese, Übergang und Werkzeug; nichts, was in sich endet und was damit als eigenständige Instanz aufzufassen wäre.
Im normalen Modus hat der Bewusstseinsfilm eine große Suggestionskraft. Er hypnotisiert den Betrachter und bindet dessen gesamte Aufmerksamkeit auf die Phänomene und Inhalte aus denen sich der Film zusammensetzt. Durch die Bindung der Aufmerksamkeit steuert er das Verhalten nahtlos. Um das selektive Interesse von all dem abzulösen, was dem Ich durch sein Dasein an Thematik zufällt, benutzt der Meditierende sogenannte Meditationsobjekte. Dabei handelt es sich um Objekte auf die er seine Wahrnehmung bündelt um durch die Bündelung der Aufmerksamkeit auf das ausgewählte Objekt den Blick vom hypnotisierenden Film zu lösen.
Das heißt zugleich: Objekte sind Erscheinungen. Sie erfüllen ihr Wesen, nämlich die Erkennbarkeit, erst in Gegenwart eines Betrachters.
Das wohl am häufigsten ausgewählte Meditationsobjekt ist die Atmung. Vordergründig hat sie den Vorteil, immer und überall dabei zu sein. Sie kann leicht bewusstgemacht werden und bietet ein überschaubares Feld der Betrachtung.
Die Atmung hat aber auch eine tiefe Bedeutung. Sie ist das Tor zwischen Leben und Tod und damit das Tor zwischen Sein und Erscheinung. Diesseits der Atmung befinden sich die Erscheinungen und damit das, was vom Sein vorübergehend verwirklicht ist. Jenseits der Atmung liegt zeitlose Möglichkeit. Da die Grenze zwischen Leben und Tod zugleich die Verbindung zwischen beiden ist, durch die das eine ins andere übergehen kann, eignet sich die Fokussierung des Atems besonders dazu, über die bloße Erscheinung hinauszublicken und nach dem Ausschau zu halten, was zeitlos ist: die Wahrheit, die einzig dazu führen kann, dass sich das Ich in ihrem Spiegel richtig erkennt.
Die Konzentration auf Meditationsobjekte ist ein Mittel, um sich der Stelle zu nähern, an der der Übergang ins Zeitlose wahrscheinlicher wird. Der Übergang ins Zeitlose kann durch mangelnde Objektkonstanz verhindert werden.
Mangelnde Objektkonstanz ist ein Begriff der Entwicklungspsychologie. Er verweist auf die Tatsache, dass Kinder Angst bekommen, wenn die Mutter (das schützende Objekt) ihr Blickfeld verlässt. Das verängstigte Kind weiß nicht, dass die Mutter nur vorübergehend verschwunden ist und bald wieder auftauchen wird.
Mangelnde Objektkonstanz kann als Erklärung dafür dienen, warum die Ablösung vom Gegenständlichen an der Schwelle zur Zeitlosigkeit in der Regel nicht gewagt wird.
Anonymität
Anonym geht auf Griechisch anonymos [ανωνυμος] = ohne Namen zurück. Kein Name heißt keiner bestimmten Person zugeordnet.
In der Tat: Als Atmung erkennt der Beobachter ein Phänomen, das allen Personen eigen ist, ungeachtet ihrer individuellen Eigenarten. Wer die Atmung im Vordergrund des Bewusstseins hält, hat sich von seinem Ego soweit gelöst, dass dessen aufs Persönliche verengte Themen nicht mehr das Bewusstsein beherrschen. Der Herrschaft des Egos zu entrinnen, ist der eigentliche Schritt zur inneren Freiheit. Der Verengung zu entkommen, ist der Schritt in die Weite.
Wohlgemerkt:
Eigentlich gibt es kein Ego, unter dessen Herrschaft man leiden könnte. Es gibt nur eine egozentrische Illusion, die die Wahrnehmung der Wirklichkeit verzerrt.
Ich achte auf das, was jetzt in meinem Bewusstsein geschieht. Nichts davon muss ich verändern. Je mehr ich erkenne, desto mehr wird diese Erkenntnis die Art verändern, wie ich die Wirklichkeit erlebe; und die Art, wie ich ihr in Zukunft spontan begegne.
Eine Sitzgelegenheit: je nach Vorliebe einen bequemen Sitzplatz, ein Sitzbänkchen oder ein Sitzkissen.
Es ist besser, täglich drei Minuten zu meditieren, als ab und zu fünfzehn. Längere Meditationszeiten sollte man erst wählen, wenn man sie nicht als Pflicht empfindet, die man abzuleisten hat, sondern als Freiraum, in den man eintaucht. Besser man erkennt, wie schwer es momentan ist, sich zu konzentrieren, als dass man sich beim Versuch, es zu tun, einem Zwang unterwirft.
Prinzipiell ist alles, was man erkennen kann, ein Objekt. Das Subjekt ist kein Objekt. Das Subjekt ist die Instanz, die die Objekte erkennt. Als primäres Meditationsobjekt wird meist der Atem gewählt. Weitere Objekte, die im Bewusstsein auftauchen, sind...
Alle Objekte, die man erkennen kann, sind nachrangige Wirklichkeit. Die Instanz, die erkennt, ist vorrangige Wirklichkeit. Das Alltagsbewusstsein neigt dazu, Objekten zum Nachteil des Subjekts Vorrang zu geben.
Da alles Bedingte der Vergänglichkeit unterworfen ist und daher sowieso wieder verlorengeht, kann man mit Bedingtem auf Dauer nicht zufrieden sein. Sucht man das Gute bloß im Bedingten, kann man niemals dorthin kommen, wo man mit sich und seinem Leben wirklich zufrieden ist. Je mehr man sich an Bedingtes klammert, desto realer ist die Gefahr des Verlusts (Dukkha).
Die Grundmuster der Wirklichkeit zu erkennen, wird als Vipassana-Meditation bezeichnet. Die Konzentration auf ein Meditationsobjekt heißt Samatha-Meditation.
Im üblichen Modus der Wirklichkeitsdeutung setzt sich der Mensch mit seiner Person gleich. Er identifiziert sich mit dem Körper und den mentalen Prozessen, die mit dem Körper verbunden sind. Im üblichen Modus glaubt man: Ich selbst und meine Person sind deckungsgleich.
Das ist eine verkürzte Sichtweise auf die Struktur der Wirklichkeit. Tatsächlich erscheint das Selbst in der und als die Person, deren Rolle die Person im dualistischen Erfahrungsfeld der Wirklichkeit spielt. Das Selbst geht aber über die Person hinaus. Die Person erscheint als erkennbares Objekt in der Zeit. Das Selbst liegt als erkennende Instanz jenseits davon.
Der übliche Ansatz zur Meditation besteht darin, sich auf ein Meditationsobjekt zu konzentrieren; zum Beispiel den Atem. Der Ansatz ist gut. Er kann aber eine Kehrseite haben, die vereitelt, dass man erreicht, was man erreichen möchte.
Konzentration zielt darauf ab, die Psyche daran zu hindern, in der egozentrischen Vorstellungswelt persönlicher Motive, und damit im Horizont vorübergehender Inhalte umherzuschweifen. Ziel, zumindest der spirituellen Meditation, ist es, das bloß Vorübergehende hinter sich zu lassen, um im zeitlosen Kern des eigenen Wesens aufzugehen.
Sich auf ein Ziel oder auf ein Objekt zu konzentrieren, ist jedoch seinerseits eine Aktivität des Egos, und je mehr man es dazu anhält, die Konzentration zu halten, desto größer ist die Aufgabe, die man ihm übergibt. Wie soll man aber etwas hinter sich lassen, dem man eine wichtige Aufgabe übergeben hat?
Eine Lösung kann darin bestehen, sich in Akzeptanz statt in Konzentration zu üben. Sich auf ein Objekt zu konzentrieren heißt zugleich, sich mit diesem Objekt als einzigem Inhalt des Bewusstseins zu begnügen. Sich zu begnügen heißt zu akzeptieren, nicht mehr als das zu haben, womit man sich begnügt. Da das bestimmende Motiv des Egos darin besteht, mehr haben zu wollen, führt die Akzeptanz des Wenigen dazu, dass man ihm Bedeutung entzieht. Was uns daran hindert, im Zeitlosen aufzugehen, ist die Bedeutung, die wir uns im Zeitlichen zumessen.
Eigentlich ganz logisch
Je mehr man sich auf etwas konzentriert, desto mehr blendet man alles andere aus. Anderes auszublenden heißt, darauf zu verzichten, durch das Ausgeblendete bereichert zu werden. Die Schwierigkeit, sich in der Meditation auf das Meditationsobjekt zu konzentrieren, deutet auf den Anspruch hin, von außen etwas Gutes zu bekommen. Oder die Furcht vor etwas Bösem ist so mächtig, dass man wachsam bleibt.
Meditation geht, über lateinisch meditari = nachdenken, einüben, auf die indoeuropäische Wurzel me[d] = abmessen, abschreiten zurück. In der spirituellen Mediation wird die Bedeutung der eigenen Person neu vermessen. Die große Hürde besteht darin, zu akzeptieren, wie gering sie ist. Wer akzeptiert, ist frei. Wer glaubt, er sollte mehr sein, bleibt im Ego gefangen.
Absolut man selbst zu sein, ist etwas anderes, als das relative Selbst, also sich selbst als Person zu erkennen. Als Person ist man ein bestimmtes Sosein, das da, wo es ist, so ist, wie es ist. Jedes Dasein wird durch die Umstände mitbestimmt, in die es eingebunden ist.
Um die Person durch meditative Betrachtung zu erkennen, empfiehlt die bisherige Anleitung, den Atem zu fokussieren, den Inhalt auftauchender Gedanken zu bestimmen, die Qualität auftauchender Gefühle zu erleben und das Ziel entsprechender Impulse zu erkennen. All das macht Sinn, um das relative Selbst als Objekt und Konstrukt zu verstehen.
Solange das Interesse aber an den Inhalten des Bewusstseins und damit an den konkreten Eigenschaften des Ich aufrechterhalten bleibt, bleibt auch die Bindung an etwas Bestimmtes und damit Verengtes und Vorübergehendes bestehen. Wer weiter will, kann weiter gehen. Dabei helfen die Wörter bloß und nur.
Bloß und nur
Was bloßliegt, liegt offen zu Tage. Es kann erkannt werden. Damit ist es ausgesetzt. Was ausgesetzt ist, ist der Vergänglichkeit unterworfen. Es fehlt ihm an eigenständiger Festigkeit. Es fließt vorüber. Als Erscheinung ist es unvermischt, nur und ausschließlich das, als was es erscheint. Hinter ihm steht aber die Möglichkeit, alles andere sein zu können.
Das Adverb nur weist dem, was damit charakterisiert wird, eine bloß bedingte Daseinsform zu. Das ist nur ein Baum heißt: Er wäre nicht, wenn es keine Ursachen gäbe, die sein Dasein ermöglichen. Der konkrete Baum ist dabei bloß eine Möglichkeit von vielen. Als bestimmter Baum ist er zwar etwas Besonderes, es fehlt ihm aber die Bedeutung des Grundsätzlichen.
In der vertieften Meditation, wird nach dem Grundsätzlichen gefragt. Es geht nicht um die konkrete Person, die als relatives Selbst durch bestimmte Inhalte festgelegt wird. Es geht um die Entbindung vom bloß Konkreten ins Absolute, also ins Sein an sich.
Deshalb heißt es jetzt:
Nichts von alldem ist jenseits der Erscheinung. Nichts von alldem ist wahres Sein.
Fesseln
Lust und Stolz sind Erfahrungen, die uns dazu ermutigen, am egozentrischen Selbstbild festzuhalten. Klar: Wer Angenehmes erlebt, hat wenig Grund, die Rolle aufzugeben, aus der heraus er es tut. Das komplementäre Gefühl zur Lust ist der Ekel. Das komplementäre Gefühl zum Stolz ist die Scham.Tauchen in einem meditativen Prozess Ekel- und Schamgefühle auf, kann das die Bindung ans Ego lockern. Beide Gefühle haben aber nicht die Macht, die Bindung zu lösen.
Da sowohl Abgrenzung als auch der Anspruch, mehr zu sein, als man ist, egozentrische Bestrebungen sind, dämpfen Ekel und Scham einerseits zwar die Freude am egozentrischen Dasein, andererseits halten sie aber am egozentrischen Selbstbild fest.
Auch hier gilt es, sich klarzumachen, dass Ekel und Scham bedingte Funktionen sind, die jenseits ihrer bedingten Funktion keine Bedeutung haben. Es sind Erlebnisse, die man hinter sich lassen kann.
Übungen der Konzentration spielen in der spirituellen Meditation eine große Rolle. Konzentration, also die Bündelung der Aufmerksamkeit auf einen Punkt, ist aber nicht das letzte Ziel. Sie ist Werkzeug und Etappe. Die Bündelung der Konzentration auf ein bestimmtes Meditationsobjekt führt dazu, dass sich das Bewusstsein von seiner umherwandernden, und damit jeweils flüchtigen Bündelung auf die egozentrischen Themen der individuellen Persönlichkeit löst. Das Ego ist wie eine Reuse, in der sich der Aal auf der Suche nach Befreiung von genau dem Unbehagen windet, das durch die aussichtslose Suche im Innenraum der Reuse aufrechterhalten wird.
Die endgültige Freiheit des Geistes liegt nicht in der Konzentration auf einen Gegenstand. Sie liegt in der Gegenstandslosigkeit. Erst wenn der Geist von der Konzentration auf das Meditationsobjekt ablässt, erfährt er sich als ungeteiltes Selbst, das sich in kein Objekt begrenzt. Dann erkennt der Geist, dass er jenseits der Objekte ist.
Vorder- und Hintergrund
Der Materialist fokussiert Objekte. Der spirituelle Mensch fragt, woher die Objekte kommen. Er findet die Leere, also das Feld, das die Objekte enthält. Um zu verstehen, was Leere bedeutet, reicht es aber nicht, das Wort zu denken. Es gilt sich als Leere zu verstehen. Sich als Leere zu verstehen, heißt über die Objekte hinauszuschauen. Objekte sind endlich. Sonst wären sie keine. Wenn es ein Subjekt gibt, ist es nicht endlich. Sonst wäre es ein Objekt.
Die Befreiung des Geistes ist nicht nur ein operationelles Problem, das allein durch geeignete Meditationstechniken zu erreichen wäre. Die Freiheit bedarf auch einer ethischen Reife, die sich im Umgang mit anderen niederschlägt. Wer frei sein will, muss andere frei lassen. Eine Untersuchung der Dynamik des Bösen verdeutlicht das.
Böse Taten sind Versuche, sich auf Kosten anderer Macht zu verschaffen. Das Motiv ist klar: Das Böse will sich aus Angst und Enge befreien. Macht erscheint ihm als geeignetes Mittel. Die Methode ist im Abschluss aber untauglich, weil jeder Versuch, die Freiheit eines Anderen zu beschränken, zu einer Fokussierung auf dessen Person führt. Mehr noch: Das Böse ist aggressiv. Es misst der Beherrschung anderer so viel Bedeutung bei, dass es an sie herantritt (lateinisch adgredi = herantreten) und somit den Raum verengt, in dem es die eigene Freiheit verwirklichen könnte. Alles Böse zu unterlassen, das unterlassen werden kann, ist ein unverzichtbarer Schritt auf dem Weg in die Freiheit.
Es macht keinen Sinn, das Böse zu hassen, weil man durch Hass selbst zu Bösem wird. Gutes und Böses gehen beide aus dem Absoluten hervor. Das Böse kann als Mittel des Absoluten verstanden werden. Dank des Bösen haben wir die Möglichkeit, uns von ihm zu unterscheiden und damit gut zu werden. Als Ausdruck des Absoluten unterliegt das Böse nicht unserer Gerichtsbarkeit. Da alles zugrundegeht, was sich nicht abgrenzen kann, macht es jedoch Sinn, sich gegen Böses von außen zu schützen.
Ängste, die entfallen können
Der vorliegende Text beschreibt einen Weg zum absoluten Selbst. Je mehr man sich dem Absoluten aber nähert, desto mehr erklären Wegbeschreibungen nicht nur, sondern sie überschreiben und verschleiern zugleich mit Sekundärem. Sekundär sind Konzepte über das Wesen der Wirklichkeit, die sich zum Bewusstsein verdichtet haben.
Betrachten wir den Begriff Bewusstsein und seine englische Entsprechung consciousness.
In Bewusstsein tauchen die Vorsilbe be- und das Verb wissen auf. Wie in bewässern zeigt die Vorsilbe an, dass etwas hinzugefügt wird: hier Wasser, dort Wissen.
Beide Sprachen verweisen unisono darauf, dass das Bewusstsein kein ungetrübtes Werkzeug der Wahrheitsfindung ist, sondern tatsächlich oder vermeintlich Gewusstes zu dem hinzufügt, was der erkennende Geist als Wirklichkeit betrachtet. Gewusstes kann als Bild dargestellt werden oder als Gedanke verbalisiert. Hält das Bewusstsein nun Ausschau nach dem Absoluten, fügt es seinem Wesen gemäß allem, was in seinem Blickfeld auftaucht, das hinzu, was es darüber zu wissen glaubt. Im Alltag mag das sehr sinnvoll sein. Da sein Wissen über das Absolute aber bloß auf Mutmaßungen beruht, ist die Gefahr groß, dass das meiste hier weitgehend falsch ist und in die Irre führt.
Sich dessen in der Meditation gewahr zu sein, ist ein Schutz vor dem Irrtum. Gewahrsein und Bewusstsein sind nicht dasselbe. Das Gewahrsein begnügt sich beim Erkennen mit dem tatsächlich Wahrnehmbaren. Es verzichtet darauf, es durch kognitive Konzepte zu verfälschen. Um zwischen Bewusstsein und Gewahrsein sorgsam zu unterscheiden, bedarf es geübten Gewahrseins, damit sich das Bewusstsein nicht vorlaut in den Vordergrund drängt. Üben Sie zu sehen, ohne zu wissen.
Über die Meditation wird viel Gutes berichtet. Zu Recht! Die menschliche Psyche wäre aber ein simples Konstrukt, wenn es in ihrem Fahrwasser nicht auch Problemfelder gäbe. Drei seien benannt:
Wer meditiert, sitzt still - wie ein braves Kind, das nicht stört. Wer ein braves Kind gewesen ist, kann sich fragen, ob sein Interesse an der Meditation nicht kindlichen Mustern entspricht, die er nie überwunden hat. Wie das brave Kind erwartet der Meditierende einen Lohn für den Verzicht auf die Ausführung seiner Impulse. Beim Kind mag das die Zuneigung der Eltern sein. Beim Meditierenden ist es der Zugang zu "höherer" Erkenntnis; oder gar ein glückseliges Aufgehen im Absoluten.
Findet die Psyche während der Meditation keine Ruhe, kann das ein unbewusster Widerstand dagegen sein, sich in die Rolle eines braven Kindes zu fügen. Andererseits mag das brave Kind, das sich bereitwillig fügt, erst recht nach Höherem streben und so viel Geduld beim Stillsitzen aufbringen, bis sich das Höhere öffnet. So kann die frühkindliche Prägung dem Erfolg spiritueller Bemühungen ebenso im Wege stehen wie Vorschub leisten. Und sie kann eine Wiederholung kindlicher Muster sein, die biographische Reifungsprozesse durch Fixierung blockiert.
Jemanden aus dem Lotussitz heraus anzugreifen ist ohne umständliche Entflechtung der Beine nicht möglich; was einem potenziellen Gegner signalisiert, dass man keine Gefahr für ihn ist. Darüber hinaus entspricht die knieende Haltung des Bänkchenbenutzers einer Unterwerfungsgeste, die seit Menschengedenken eine asymmetrische Beziehung definiert, die eindeutig zwischen Dominanz und Demut unterscheidet.
Daraus kann man schließen: Menschen, die sich meditative Ziele setzen, sind eher solche, die Konflikten und der Konkurrenz um irdische Güter aus dem Wege gehen. Das passt zur Rolle des braven Kindes. Dessen Strategie rechnet damit, dass es besser ist, sich die Gunst anderer nicht zu verscherzen, statt mit ihnen um Rang und Macht zu kämpfen.
In der spirituellen Praxis ist die Des-Identifikation von Körper und Ego ein gängiges Mittel um das Selbstbild über den Horizont der Person hinaus zu erweitern.
Der Des-Identifikation kann aber auch ein neurotischer Abwehrmechanismus zugrunde liegen, der das Selbstbild nicht ins Heilsame erweitert, sondern durch Spaltung beschädigt.
Manuel wurde als Kind weit weniger freudig begrüßt, als es unter besseren Bedingungen möglich gewesen wäre. Im Sinne eines Wiederholungszwangs agiert er das Gefühl, abgelehnt zu werden, aus, indem er seiner Person jede Bedeutung abspricht.
Fazit: Spirituelle Techniken, als deren Resultat der Körper nicht mehr wertgeschätzt wird, als vor ihrer Anwendung, sind verdächtig. Wer Körper und Person abwertet, spaltet, statt sich zu etwas Ganzem zu vereinen.
Dass Meditation nicht nur heilsame Effekte hat, sondern auch seelische Turbulenzen auslösen kann, ist bekannt (z.B.: Willoughby Britton). Die introspektive Konfrontation mit seelischen Konflikten kann Ängste, Schlafstörungen und Depressionen triggern; gegebenenfalls sogar eine Psychose.
Meditation kann mit so viel Ehrgeiz betrieben werden - um endlich die verheißene Erleuchtung zu erlangen -, dass sie zu einem Stressfaktor wird; vor allem, wenn die Des-Identifikation von Körper und Person mit einer autoaggressiven Vehemenz erfolgt. Denkbar ist, dass sie dann autoimmune Reaktionen verstärken oder sogar anstoßen kann.