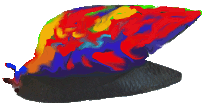
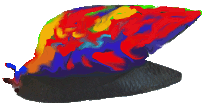
Vor der Diagnose einer somatoformen Störung empfiehlt sich eine gründliche körperliche Untersuchung.
Der Begriff somatoform setzt sich aus griechisch soma (σωμα) = Körper und lateinisch forma = Form, Gestalt zusammen. Er verweist somit auf Beschwerden, die in Form körperlicher Symptome auftreten, jedoch eigentlich psychischer Natur sind.
Ein weiterer Begriff, der bei der Benennung körperlicher Symptome verwendet wird, ist der des funktionellen Syndroms. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass den Beschwerden des Patienten zwar keine erkennbare, strukturell körperliche Ursache zugeordnet werden kann, man aber davon ausgeht, dass ihnen Störungen der biochemischen Funktionsabläufe zugrunde liegen könnten; die zwar körperlicher Natur sind, mit den aktuellen Möglichkeiten der Diagnostik aber nicht aufgedeckt werden können.
Der Begriff somatoform unterstellt im Gegensatz dazu, dass das Symptom nicht wirklich körperlicher Natur ist, sondern bloß in entsprechender Gestalt auftaucht.
Bei somatoformen Störungen erlebt der Kranke körperliche Symptome, für die keine körperliche Ursache aufgedeckt werden kann; oder aber, das Ausmaß des Leidensdrucks ist durch die geringen körperlichen Befunde, die dennoch bestehen, nicht erklärbar. Oft sucht der Kranke verschiedene Ärzte auf, um sich erneut untersuchen zu lassen. Typischerweise kann er beruhigende Untersuchungsergebnisse kaum glauben. Stattdessen ist er überzeugt, der Arzt habe etwas Wichtiges übersehen oder nehme sein Leiden nicht ernst.
Der Verlauf solcher Erkrankung ist meist chronisch. Die Symptomausprägung ist schwankend und hängt mit sozialen und zwischenmenschlichen Problemen zusammen.
Der Unterschied zwischen bloßem Symptom und echter Störung wird an der Reaktion des Kranken auf die beruhigende Botschaft des Arztes erkennbar, dass keine schwerwiegende körperliche Ursache vorliegt.
Der Unterschied zeigt, dass der Glaube an das körperliche Kranksein beim Patienten mit eigentlicher somatoformer Störung eine psychodynamische Bedeutung bei der Regulation seines Selbstbilds und seines Bezugs zum Umfeld hat. Man könnte sagen: Er braucht die Störung, um andere Problemfelder auszublenden.
Somatoforme Störungen können alle denkbaren körperlichen Symptome hervorbringen. Teils fluktuiert die Symptomatik und macht sich mal da und mal dort am Körper bemerkbar, teils bleibt sie an bestimmte Körperregionen bzw. Organsysteme gebunden.
Somatoforme Störungen gemäß ICD-10-Klassifikation der WHO
| Name | ICD | Kernsymptome |
| Somatisierungsstörung | F45.0 | Wechselnde körperliche Symptome intensiver Ausprägung über mindestens zwei Jahre |
| Undifferenzierte Somatisierungsstörung | F45.1 | Wie F45.0, aber unvollständige Ausprägung und/oder kürzerer Verlauf |
| Hypochondrische Störung | F45.2 | Besorgtes Grübeln über die Möglichkeit, an einer noch unentdeckten Erkrankung zu leiden |
| Somatoforme autonome Funktionsstörung | F45.3 | Symptomenkomplex, der einem vegetativ innervierten Organsystem zugeordnet werden kann |
| Anhaltende somatoforme Schmerzstörung | F45.40 | Chronische Schmerzen, als deren Grundlage psychische Spannungen angenommen werden |
| Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren | F45.41 | Chronische Schmerzen bei gesichertem Vorliegen einer körperlichen Grundlage, deren Ausdruck und Erlebnisintensität jedoch durch psychische Faktoren ausgestaltet wird |
| Sonstige somatoforme Störungen | F45.8 | Nicht an vegetatives System gebunden |
Bei der Somatisierungsstörung kommt es zu häufig wechselnden körperlichen Symptomen. Sie können sich auf jeden Körperteil oder auf einzelne Organsysteme beziehen. Aufgrund der häufig wechselnden Symptomatik wird auch von multipler psychosomatischer Störung gesprochen.
Bei der hypochondrischen Störung leidet der Patient weniger unter konkreten Symptomen und mehr unter Befürchtungen, dass an sich harmlose Körperwahrnehmungen auf schwere, aber noch unentdeckte Krankheiten hindeuten. Der Hypochonder neigt dazu, normale Körperwahrnehmungen, wie Herzklopfen, Darmgeräusche oder Knacken der Gelenke, als bedrohliche Vorboten des Untergangs anzusehen. Dementsprechend beobachtet er seinen Körper genau... und nimmt dadurch erst recht bedenkliche Symptome wahr.
Die autonome Funktionsstörung ähnelt der Somatisierungsstörung. Während die Symptome bei der Somatisierungsstörung aber wechselnd und diffus über den Körper verteilt sind, spricht man von einer autonomen Funktionsstörung, wenn der Patient sein Leiden auf ein spezifisches Organsystem bezogen erlebt, das vollständig der Kontrolle des vegetativen Nervensystems unterliegt.
Betroffene Organsysteme
| ICD | Organsystem |
| F45.30 | Herz-Kreislauf-System |
| F45.31 | Oberes Verdauungssystem |
| F45.32 | Unteres Verdauungssystem |
| F45.33 | Atmungssystem |
| F45.34 | Urogenitalsystem |
| F45.37 | Mehrere Organe und Systeme |
| F52.6 | nichtorganische Dyspareunie |
Häufige Symptome sind:
Bei der Schmerzstörung ist starker Schmerz das Leitsymptom, das alle anderen überschattet. Am häufigsten sind Kopf- und Rückenschmerzen. Es kommen aber auch Gesichtsschmerzen, Gelenk- und Gliederschmerzen sowie Leib- und Unterleibsschmerzen vor.
Bei den chronischen Schmerzstörungen sind zwei Formen zu unterscheiden.
Chronisches Schmerzsyndrom ohne organische Grundlage. Dabei geht man davon aus, dass das Schmerzerleben primär seelisch verursacht ist.
Zu den sonstigen somatoformen Störungen zählt man Störungen, deren Art und Lokalisation nicht mit einem Versorgungsgebiet des vegetativen Nervensystems zusammenfallen. Zu nennen sind Bruxismus (Zähneknirschen), Schluckstörungen und Kloßgefühl im Hals, psychogener Juckreiz, Beschwerden rund um den weiblichen Zyklus (Dysmenorrhoe). Auch der psychogene Schiefhals (Tortikollis) wird hier eingeordnet, obwohl seine Zuordnung zu den Konversionsstörungen schlüssiger wäre.
Da bei den somatoformen Störungen kein körperlicher Befund erhoben werden kann, der die Beschwerden erklärt, bleibt die Diagnose grundsätzlich hypothetisch. Immerhin muss beachtet werden, dass die Medizin keineswegs alle Krankheitsprozesse erschöpfend erforscht hat. Neben seelischen Ursachen sind bei somatoformen Beschwerden daher körperliche Ursachen denkbar; die bloß noch nicht erkannt sind.
Denkbare Ursachen
Vieles deutet darauf hin, dass seelische und psychosoziale Faktoren eine wesentliche Rolle spielen. Zum einen findet man eine enge Verbindung zwischen Symptomintensität einerseits und dem jeweiligen Pegelstand zwischenmenschlicher Spannungen andererseits. Bemerkenswert ist dabei, dass dieser Zusammenhang dem äußeren Betrachter oft plausibler erscheint, als dem Patienten selbst.
Daraus hat man den Begriff der Alexithymie (= Gefühlsleseschwäche) abgeleitet. Der Begriff benennt den Umstand, dass psychosomatisch erkrankte Menschen oft wenig Übung darin haben, ihre eigenen Emotionen, Widersprüche und Impulse "auszulesen". Oder sie vermeiden den Blick nach innen um von gefürchteten seelischen Konflikten abzusehen und um unerwünschte Tatsachen zu verdrängen.
Vermutlich besteht ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der verminderten Wahrnehmung seelischer Inhalte und der verstärkten Beachtung körperlicher Phänomene. Im Sinne eines konversionsneurotischen Übertritts seelischer Konflikte auf die körperliche Ebene drückt der Patient seine seelische Not durch die Sprache der Symptome aus und vermeidet zugleich das Risiko, sie unverschlüsselt zu benennen.
Somatoforme Symptome aller Art - Spannungskopfschmerz, Druck auf der Brust, Stiche hier oder dort, Verdauungsbeschwerden etc. - treten bei belastenden Erlebnissen und unspezifischem Stress bei fast allen Menschen gelegentlich auf. Letztlich kann sogar die Schlafstörung als somatoformes Symptom aufgefasst werden, weil sie einen gestörten körperlichen Funktionszustand darstellt, dem zumeist psychische Probleme zugrunde liegen.
Zu glauben, dass hinter solcherlei Symptomen eine bedrohliche Erkrankung steckt, ist aber seinerseits neuer Stress, der über die hormonelle und vegetative Kopplung von Seele und Körper körperliche Funktionen beeinträchtigen kann. Dadurch entsteht bei dem, der sich durch keine beruhigende Botschaft beruhigen lässt, eine Verstärkung pathogener Faktoren, die im schlimmsten Fall das Risiko einer tatsächlich körperlichen Erkrankung erhöht. Negativer Stress ist einfach nicht gesund.
Die Tatsache, dass sich der Kranke nicht über Normbefunde bei der körperlichen Untersuchung freut, verweist auf sein eigentliches psychisches Kranksein. Dem Kranken wäre es gewissermaßen lieber, er wäre nachweislich körperlich krank; obwohl genau davon eine reale Gefahr ausginge.
Drei Erklärungen sind dafür möglich...
Das Vertrauen des Kranken in Kompetenz und Wohlmeinen anderer - insbesondere seiner zahlreichen Ärzte - ist so gering, dass er nicht vertrauen kann. Vielleicht liegt dem die Verschiebung eines fehlenden Urvertrauens zugrunde, das eigentlich in andere Beziehungsfelder gehört.
Das Sicherheitsbedürfnis des Kranken ist so hoch, dass er auch die allerletzte Möglichkeit eines Irrtums der ärztlichen Diagnostik ausgeschlossen wissen will; was schlicht unmöglich ist. Dann liegt seiner ins Leere laufenden Suche nach Gewissheit etwas zwanghaft Perfektionistisches inne, der eine überwertige Identifikation mit Elementen des relativen Selbst entspricht.
Der Themenkomplex rund um das hypothetisch körperliche Kranksein spielt im Selbstbild des Kranken und im Rahmen seines Umgangs mit Bezugspersonen eine vermeintlich unverzichtbare Rolle. Der Nachweis einer körperlichen Erkrankung könnte zu Mitleid und Schonung führen.
Wahrscheinlich kommt der letzten Möglichkeit eine besondere Bedeutung zu. Die Bündelung der Aufmerksamkeit auf somatoforme Symptome und hypochondrische Befürchtungen blendet andere Probleme aus. Sie schützt vor der Auseinandersetzung mit sich selbst...
Die Abgrenzung gegenüber den Erwartungen anderer ist oft nur Teilkomponente einer grundlegenderen neurotischen Problemlösung. Häufig sind somatisierende Kranke in Beziehungen eingebunden, die viel Verzicht auf Selbstbestimmung erfordern. Im Glauben, auf Zugehörigkeiten - privater oder beruflicher Natur - unverzichtbar angewiesen zu sein, beharrt der Kranke auf einem objektivistischen Erklärungsmuster körperlicher Alarmsignale, das ihn einer riskanten Hinterfragung seines Beziehungsverhaltens enthebt. Das ist echter Krankheitsgewinn; wenn auch teuer erkauft.
In der Therapie geht es zunächst darum, den Patienten zu ermutigen, die Symptomatik überhaupt als Folge innerseelischer Prozesse zu betrachten. Lässt er sich darauf ein, wird sein Blick nach innen geschult und seine Selbstwahrnehmung vielschichtiger. Gelingt es ihm, den Zwiespalt zwischen verschiedenen seelischen Motiven zu erkennen, lässt die Tendenz zur Somatisierung nach.
Aus gesteigertem Selbstbewusstsein heraus kann er seine Position im psychologischen Grundkonflikt besser bestimmen. Das kann dazu führen, dass er den Mut zu Entscheidungen findet, die den lautstarken Protest seines Leibes unnötig macht.
Es liegt auf der Hand: Wenn Ärzte nur eine Botschaft bieten, der man nicht glaubt, lohnt es kaum, immer neue Ärzte aufzusuchen, die dasselbe tun. Nachdem nach ärztlichem Ermessen alle sinnvollen Untersuchungen einmal oder mehrfach durchgeführt sind, tut es dem Kranken gut, nicht erneut das zur Behebung seines Leidens zu tun, was das Leid nicht behebt: weitere Ärzte aufzusuchen. Stattdessen können Leitlinien für das eigene Verhalten empfohlen werden, die erfahrungsgemäß lindernd sind.