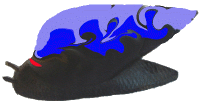
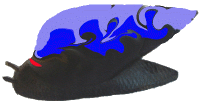
Der Kontakt
Der Respekt vor der prinzipiellen Ebenbürtigkeit aller Menschen ist die wesentlichste Voraussetzung dafür, dass existentielle Kontakte überhaupt zustande kommen. Bei jeder Begegnung spielt die Frage, ob der Selbstwert der Beteiligten geachtet wird, eine zentrale Rolle. Die Antwort darauf wird vor jeglicher Kommunikation über weitere Inhalte durch die Form der Kontaktaufnahme gebahnt. Die Formen und Rituale verraten - sofern sie nicht schon mit Absicht betrügen - ob die Haltung dessen, der sie benutzt, den Wert seines Gegenübers ebenso achtet, wie er es mit dem eigenen tut. Das gleiche gilt natürlich umgekehrt. Auch ein beflissener Bewunderer bemächtigt sich nämlich des anderen und vermeidet so den vollen Kontakt. Er tut es, indem er den anderen wie ein tönernes Idol auf einen Sockel stellt, unter dem er sich vor der Gefahr einer echten Begegnung in scheinbarer Demut wegduckt.
Der Begriff "ebenbürtig" meint, dass die Kontaktpartner "von gleicher Geburt" sind und sich dementsprechend begegnen. Der Wert des einen wird im Kontakt nur dann geachtet, wenn das gleiche auch mit dem Wert des anderen geschieht. Jeder Verachtung eines anderen Menschen entspringt eine gleichen Menge an Missachtung der eigenen Person. Wer den fremden Wert verkennt, nimmt es damit hin, dass er selbst besudelt wird, denn ein Kaiser, der einen Bettler verachtet, bespuckt unbewusst sein Spiegelbild.
Das Wort "Geburt" ist eine Zusammensetzung aus der Vorsilbe "ge = zusammen" und einer heutigen Abwandlung des althochdeutschen Verbs "beran = tragen, hervorbringen". "Von gleicher Geburt" heißt "aus dem gleichen zusammengetragen" bzw. "aus dem gleichen hervorgebracht". Ebenbürtige gehen also davon aus, dass sie auf der tiefsten Ebene ihres Wesens, die alle anderen Ebenen an Tragweite übertrifft, von gleichem Ursprung sind.
Die Qualität eines jeden Kontaktes kann man zwischen zwei gegensätzliche Pole einordnen. Auf der einen Seite steht der vollständige wechselseitige Respekt, auf der anderen die maximale narzisstische Rivalität. Das eine ist Liebe, das andere Feindschaft.
Beim gesunden Kontakt begegnen sich die Partner, trotz aller Unterschiede, die ihren jeweiligen sozialen Rollen eigen sind, als ebenbürtige Personen. Es bleibt von vornherein deutlich, dass der eine zu allererst des anderen existentielle Gegenwart ist und dass alle später übernommenen Rollen die ursprüngliche Gleichheit nicht überwiegen.Als eine Gegenwart ist mir der andere gegenüber. Er ist weder drunter noch ist er drüber!
Wenn man sich duckt oder sich überhebt, kann man dem Hier und dem Jetzt nicht gegenwärtig sein, sodass man sein Leben nur zum Teil durch ein eigenes Dasein erfüllt. Nur der Ebenbürtige ist ganz da, wo ihm die Welt, aus der er sich erhebt, begegnet. Tatsächlich Kaiser kann daher nur sein, wer sich nicht über Bettler erhebt, denn das Erhabene ist dem Banalen immanent.
Wenn sie ehrlich miteinander sind, wissen Kaiser und Bettler genau, dass die Verteilung der Rollen kaum je das alleinige Verdienst unabhängiger Individuen, sondern größtenteils Ergebnis des Zufalls und überpersönlicher Kräfte ist. Der äußerliche Erfolg im Leben ist oft mehr Schicksal als Verdienst und kein Thron, auf den sich ein echter Hintern setzen kann, steht irgendwem aus eigener Tüchtigkeit von allein zu. Im ursprünglichen Kontakt gestehen sich Kaiser und Bettler schon durch die Form ihrer Begegnung wortlos ein, dass keiner der beiden eine autonome Einheit ist, die sich selbst erschaffen und am Leben halten könnte. Im Hinblick auf die reale Struktur der Individualität ist deshalb jedes Verhalten inadäquat, das die Bedeutung des anderen für das eigene Sosein missachtet. Daher hat auch niemand ein legitimiertes Recht, sich eines anderen in einer Weise zu bedienen, mit der dieser nicht ausdrücklich einverstanden ist. Die definierten Rollen bleiben im Alltag zwar bestehen, es wird im gesunden Kontakt jedoch anerkannt, dass es jenseits der Rollen eine tiefere Ebene der Begegnung gibt. Die Aufgabe der Rollen ist es, den Vordergrund des sozialen Gefüges im Dienste funktionaler Effizienz zu ordnen, damit im Hintergrund die Begegnung auf der existentiellen Ebene der ebenbürtigen Schicksalsgemeinschaft "Mensch" zustande kommt.
Beim kranken Kontakt handelt man entweder aus der narzisstischen Illusion persönlicher Souveränität heraus, oder man tut umgekehrt so, als ob man selbst das Anhängsel eines großartigen Gegenübers wäre, welches den Unterwürfigen zur Belohnung seiner Unterwürfigkeit vor den Unbilden des Daseins und der eigenen Aggressionen beschützt. In jedem Falle strebt man eine Rolle an, die sich nicht am effizienten Funktionieren einer Gemeinschaft orientiert, sondern das Einzelinteresse in unausgesprochener Form in den Vordergrund stellt, ohne die Relativität jedes Einzelinteresses einzugestehen.
So wie das Kriterium der Ebenbürtigkeit nur in der Begegnung wirklich relevant wird, so ist auch das Verfehlen der Ebenbürtigkeit, nämlich der Narzissmus, nur als eine Beziehungsstörung zu verstehen. Beim Narzissmus geht eine Kontaktstörung Hand in Hand mit der libidinösen Hinwendung des Ichs zu sich selbst.
Die Ursachen der narzisstischen Kontaktstörung können entweder aus der existentiellen, der biologischen, der psychologischen oder der soziologischen Perspektive heraus gedeutet werden. Als gemeinsames Resultat aller Betrachtungsweisen erscheint das Wesen des Narzissmus als eine Mischung aus Selbstwertzweifeln und Größenphantasien, die verleugnet und versteckt werden, weil sie bei Licht betrachtet nicht haltbar sind.
Auf der existentiell-ontischen Betrachtungsebene wird erkennbar, dass die Wertfrage prinzipiell ins Dasein derer eingewoben ist, die einander begegnen möchten, da sich jeder im Kontakt in dem Maße einer gemeinsamen Wahrheit stellen muss, wie der Kontakt tatsächlich zustande kommt. Alle echten Unterscheidungen des Wertseins gründen im Anspruch der Wahrheit, mehr zu gelten als Lüge und Irrtum. 'Ich bin wert' heißt 'Ich bin wahr'. Bezüglich dieser Art Wahrhaftigkeit kann es zwischen Menschen zwar Wertunterschiede geben. Da die Wahrheit aber weiß, dass auch der Irrtum zu ihr gehört, während sich der Irrtum bloß blind gegen die Wahrheit verteidigt, wird der, der den Unterschied der Werte wirklich erkennt, ihn nicht benutzen, um sich durch die Leugnung der Ebenbürtigkeit von denen abzugrenzen, die sich stärker irren, als er selbst.
Biologisch betrachtet braucht man sich zwar nicht um die Wahrheit als abstraktes Gut und Gral der Philosophen zu kümmern, sehr wohl aber darum, ob es sich bei dem blassbraunen Pilz auf der Pizza, die die Gattin zum fünfzehnten Jahrestag des Ehekrieges zubereitet hat, um einen Champignon und nicht doch um einen Knollenblätterpilz handelt. Der Nährwert beider Sorten ist für die biologischen Aspekte des Gatten verschieden. Der praktisch erfahrbare Respekt vor dem persönlichen Wert hängt also, wenn man den Leib als inkarnierten Aspekt seiner selbst betrachtet, auch davon ab, was man zu essen bekommt. Er leidet nicht erst, wenn man am Gift in der Nahrung stirbt, sondern bereits wenn man beim Essen den unterschwelligen Ekel ertragen muss, den lieblos oder gar industriell gefertigte Speisen mit sich bringen.
Bei der psychologischen Perspektive stößt man auf die schwierige Aufgabe des kindlichen Ichs, sogenannte "negative und positive Selbst- und Objektrepräsentanzen", wie es im Psychologenjargon recht spröde heißt, zu einer Einheit zu verschmelzen. Gemeint ist, dass das reifende Kind es akzeptieren muss, dass weder es selbst noch der andere nur gute und wertvolle Eigenschaften hat; oder zumindest solche, die man als "gut" und "wertvoll" bezeichnet, weil man sie sofort als nützlich erkennt. Narzisstisch gesund und bereit zum vollen Kontakt wird man erst, wenn man ganz die Hoffnung fahren lässt, doch noch "bessere" Menschen zu finden, als die, die eben schon mal da sind und wenn man der Begegnung mit ihnen nicht ausweicht. Narzisstisch gesund ist man erst, wenn man es nicht nur hinnimmt, sondern es als unzweifelhaft richtig begrüßt, "bloß" man selbst zu sein und eben nicht dermaßen großartig, wie es die eigene Phantasie im Vorgriff auf ein fernes Jenseits erfunden haben mag. Authentizität ist das einzige Ideal, das die Realität nicht verrät. Im Zweifelsfalle verzichtet der Gesunde darauf, sich absichtlich zu verbessern.
Soziologisch gesehen wird der narzisstische Selbstwertzweifel durch Demütigungen verursacht, die dem einzelnen und besonders Kindern, die sich am schlechtesten dagegen wehren können, auf Schritt und Tritt begegnen. Der Zweifel am Selbstwert ist fast ebenso verbreitet wie die krankmachenden gesellschaftlichen Strukturen selbst. Seelisch gesund kann nur werden, wer zu den Sitten der Gesellschaft, in der er lebt, genügend Abstand hält.
Welcher Betrachtungsweise man nun die größere Bedeutung zumisst, ist für den praktischen Umgang mit der Forderung nach ebenbürtigen Kontakten nur von geringem Belang. Wesentlich ist vielmehr, dass die Ebenbürtigkeit und der Narzissmus nur in der konkreten Begegnung wirklich werden. Ein Eremit, der sich fälschlicherweise für den Kaiser von China hält, ist zwar aus existentialistischer Sicht zu bedauern, da er sich selbst verfehlt, er wird aber durch seinen Irrtum keine weiteren Probleme bekommen - zumindest wenn er sich wenigstens das Wasser selbst vom Brunnen holt, statt verdurstend zu erwarten, dass ein Lakai es ihm bringt. Der Wüste ist das Fehlverhalten, das aus dem Irrtum resultieren mag, egal. In der Wüste schreitet der verträumte Eremit ungestört im Sand. Im praktischen Alltagsleben jedoch ist man auf Kontakte angewiesen und man bekommt es dort mit den eigenen Schwierigkeiten zur ebenbürtigen Begegnung ebenso heftig zu tun, wie mit den Schwierigkeiten, die die anderen damit haben. Im Alltagsleben stößt man als verträumter Eremit auf tausend Wände.
Als Reaktion auf eine Vielzahl von kränkenden Beziehungserlebnissen bildet man häufig ein Kontaktverhalten aus, bei dem die Abwehr weiterer Kränkungen überwertig wird. Charakteristisch ist mangelnder Mut zur authentischen Begegnung, da man sich innerlich enttäuscht vom Mitmenschen zurückzieht, obwohl die Kontakte zu ihm formal weiterbestehen. Den tatsächlichen Bezugspunkt der eigenen Existenz verlegt man je nach Ausprägung der Störung mehr oder weniger in die eigene Person. Man lebt dann so, als ob das erstrebenswerte Gut nicht die gelungene Beziehung zum anderen wäre und die kreative Expansion hinaus in die Welt, sondern man selbst und die narzisstische Verliebtheit in ein idealisiertes Ich. Man "begegnet" folglich, als ob man ohne den anderen bereits vollständig wäre oder als ob der andere bloß eine nebensächliche Unterfunktion des eigenen zeitlosen Größendaseins ist, das seinen Wunsch und sein Ziel schon in sich trägt. Man braucht den anderen zwar, doch nicht im Eingeständnis eines eigenen Bedürfnisses nach echter Bezogenheit, sondern man tut so, als ob man ihn wie ein Mittel und Werkzeug benutzen könnte. Man begegnet ihm, als wäre er kein Du, sondern ein Es und statt zu wissen, dass man ihn tatsächlich braucht, missbraucht man ihn, ohne zu wissen, was man tut.
Eine echte Akzeptanz von Gegenwart wird im Bann der narzisstischen Illusion individueller Vollständigkeit nicht erreicht. Vollständigkeit ist ein zeitloses Phänomen, in dem Gegenwart weder als Zeitpunkt noch als Anwesenheit eines Gegenübers einen realen Platz hat. Daher bleiben alle missbräuchlichen "Begegnungen" in gewissem Sinne virtuell. Sofern man sich aus der narzisstischen Illusion herausentwickelt, gab es zwar das Falsche, in Gegenwart des Richtigen wird es aber nie wirklich stattgefunden haben. Wenn man wirkliche Begegnungen wagt, erscheint alles andere nur noch als böser Traum.
Offensichtlich oder gut versteckt zwischen den Zeilen weist die Struktur der Kontakte jedem, der daran beteiligt ist, bestimmte Rollen zu. Soweit es sich dabei um rein pragmatische Rollen handelt, die der Bewältigung des Alltags dienen und Sachproblemen bestimmte Kompetenzen zu ihrer Lösung zuordnen, zum Beispiel berufliches Fachwissen, bergen die zugewiesenen Rollen, obwohl sie Hierarchien begründen, nicht die Gefahr der Kränkung. Kränkungen im Sinne tatsächlicher Erzeugung von seelischen Krankheiten drohen jedoch dort, wo ein Kontakt so strukturiert ist, dass er ein Gefälle persönlichen Wertseins postuliert, ohne dass man den narzisstischen Missbrauch, der darin steckt, sofort erkennt. Erst ein genaues Beachten von Gestik und Wortwahl, von zugewiesenen Pflichten und wortlos beanspruchten Rechten führt zur Entdeckung der pathogenen Kräfte. Soziale Hierarchien überhaupt sind nur dann nicht pathogen, wenn sie durch sachliche Notwendigkeiten gerechtfertigt sind. Sonst sind sie krank ( = gekrümmt) im Sinne verbogener Wahrhaftigkeit.
Fraglich ist, ob die narzisstische Problematik, wie mancherorts behauptet, in den letzten Jahrzehnten tatsächlich zugenommen hat. Zu vermuten ist vielmehr, dass das Elend des verletzten Selbstwerts und der neurotischen Überkompensation seit der partiellen Enthierarchisierung der Gesellschaft deutlicher wird und als Problem auf breiterer Ebene überhaupt erst benennbar. Ein Blick in die Archive alter Wochenschauen und der trivialen Filmkunst zeigt, dass das Weltbild selbst von Kulturschaffenden bis in die fünfziger Jahre hinein feudalen Gesellschaftsstrukturen treu blieb, Strukturen, in denen die fraglose Aufteilung der Menschheit in Herren und Diener kaum jemanden die Schamesröte ins Gesicht trieb. Solange die Gesellschaft aber in diesem Feudalismus kohärent war, hatte fast jeder einen festen Platz, von wo aus er die beiden Facetten der narzisstischen Störung, nämlich die Verachtung des anderen von oben herunter und die Unterwerfung in devoter Loyalität nach oben hinauf, problemlos ausagieren konnte, ohne dass die Krankhaftigkeit dieses Normverhaltens in größerem Ausmaß hinterfragt worden wäre. Man ist damals durch solcherlei Fragen meist auch nur auf ungläubiges Kopfschütteln und, schlimmer noch, auf die bezwingende Knute einer despotischen Alltäglichkeit gestoßen.
Seit demokratische und kooperative Ansätze im Gefüge der Gesellschaft eine gewisse Verbreitung gefunden haben, besteht langfristig eine Chance zur Abmilderung des narzisstischen Problems, soweit es durch feudale Gesellschaftsstrukturen aufrechterhalten wird. In der Übergangszeit wimmelt es aber einerseits von Menschen, deren soziale Prägung sie eigentlich auf das Ausagieren ihrer Störung vorbereitet hat, denen in der veränderten Situation aber die passende Gelegenheit dazu fehlt, zum Beispiel ein sozial akzeptierter Militarismus oder ein ubiquitärer Zivilgehorsam. Andererseits ist zu befürchten, dass durch die weitere Entwicklung hochkomplexer Gesellschaftsformen genügend Neues - zum Beispiel anonyme Feldkräfte vernetzter technischer Konstruktionen - entsteht, von dem der Selbstwert des einzelnen bedroht werden wird. Doch selbst wenn die politische Entwicklung positiv verläuft, werden Selbstwert und Ebenbürtigkeit nicht durch gesellschaftliche Umstände allein gesichert und verliehen. Sie müssen immer erst, gerade nach außen hin, erstritten und im Boden persönlicher Wahrhaftigkeit verankert werden.
Menschliche Interaktionen laufen nach bestimmten Regeln ab. Die Muster, die dabei zum Ausdruck kommen, sind nicht starr, sondern schwanken innerhalb individuell verschiedener Bandbreiten. Trotzdem ist ihre Variabilität erkennbar begrenzt. Das Bündel an Verhaltensmustern, über das ein Mensch verfügt, ist für seine Person charakteristisch. Es macht folglich als Repertoire seiner Beziehungsmöglichkeiten seinen Charakter aus.
Der Begriff "Charakter" wird hier nicht bloß individualpsychologisch aufgefasst, als hafte er, in Analogie zur Haarfarbe als Merkmal des Körpers, einer individuellen Psyche unabhängig von allen Bezügen als objektivierbares Kriterium an, sondern er wird primär im Hinblick auf die Beziehungsmöglichkeiten, also das Kontaktverhalten eines Menschen gesehen, weil der Charakter im wesentlichen nur im Rahmen von Kontakten erkennbar ist und von dort aus erst als "charakteristisch" benannt wird.
Das Wort "Charakter" stammt aus dem Griechischen. Es meint "Gravur", "Brandzeichen" oder "Schriftzug". Charakter ist aber nicht nur das Ornament, welches von Vererbung und Schicksal als Gesicht in eine einst jungfräuliche psychische Masse eingeritzt wurde und dann beim Blick von außen als seelische Physiognomie erkennbar wird. Der Charakter offenbart sich vielmehr als Aktivität, denn als Struktur. Er offenbart sich als die wiedererkennbare Klarheit, mit der die handelnde Präsenz eines Menschen ihre Spur im sozialen Umfeld hinterlässt. Der Charakter eines Menschen ist ein Impuls. Er ist, was der Mensch tatsächlich bewirkt.
Die Charakterzüge eines Menschen werden daher zum größten Teil in Relation zu seinem Beziehungsverhalten definiert. Wie jemand ist, kommt in der Art zum Ausdruck, mit der er seiner Umwelt begegnet. So erkennt man den Eigenbrötler daran, dass er abgewandt von der Gemeinschaft der anderen nach eigenem Rezept Brote backt. Den Warmherzigen erkennt man, da er im Kontakt eine wärmende Emotionalität verschenkt, die der Geizige ebenso wenig hergibt wie Geld und Gut. Und den Umgänglichen nennt man so, weil es im Umgang mit ihm leicht fällt, Konflikte zu umgehen.
Treten zwei Personen miteinander in Kontakt, springt in der Regel bei jedem zunächst jenes Verhaltensmuster an, das am besten eingeschliffen ist, das einer relativ stabilen Kompromissbildung der individuellen Motive und Impulse entspricht und das für die konkrete Kontaktsituation einen möglichst reibungslosen Ablauf erwarten lässt. Diese Verhaltensmuster entsprechen sozial zugeordneten Rollen oder solchen, die man selbst wählt. Die Kontaktsequenzen, die aus diesem "Rollenverhalten" bestehen, führen meist nicht zu intensiven Begegnungen und beeinflussen die Persönlichkeit der Beteiligten nur wenig. Wenn eine formende Wirkung zu erwarten ist, handelt es sich eher um eine Tendenz zur Verfestigung bestehender Muster und nicht um deren Veränderung im Sinne eines seelischen Reifungsprozesses. Beim "Rollenverhalten" geschieht die Interaktion nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Dabei treffen weniger individuelle Personen in ihrer existentiellen Einzigartigkeit aufeinander, als vielmehr ihre jeweiligen Rollen, in denen sie austauschbar sind. Das Kriterium der Ebenbürtigkeit tritt bei dieser Kontaktform in den Hintergrund. Die Beziehungen bleiben der Asymmetrie der Rollen und ihrer Wertigkeit innerhalb der sozialen Hierarchie verpflichtet.
Im Gegensatz zur Kontaktform der Rollenspiele, die die Routine des Alltages regelt, gibt es den existentiellen Kontakt. Beim existentiellen Kontakt treten die Rollen zurück und es kommt zur Interaktion "nackter" Individuen. Während im Rollenkontakt die gewohnten Verhaltens- und Erlebensmuster stabilisiert werden, kommt es beim reinen Kontakt zur Herausforderung und Infragestellung des Gewohnten. Durch den existentiellen Kontakt können Charakterzüge verändert werden. Persönlichkeitsentwicklungen schreiten durch sie voran.
Während man sich beim Rollenverhalten auf einen Ausschnitt reduziert, damit eine ordnungsgemäße Kontaktsequenz zustande kommt, weitet man sich bei der existentiellen Begegnung aus. Hier begegnet man nicht nach einem Plan, sondern ohne sich die nächste Zukunft auszudenken und so weit der eigene Freimut eben reicht. So kommt es, dass das Rollenspiel - und zwar solange beim Spielen keiner aus der Rolle fällt - die Partner in berechenbaren Bahnen hält, während beim existentiellen Kontakt Impulse freigesetzt werden, deren Konsequenzen nicht vorher abzusehen sind. Beim existentiellen Kontakt nimmt man den Spaß des Lebens also ernst, während der Ernst, mit dem die Rollen ausgespielt werden, aus der Ferne manchmal spaßig wirkt.
Beim psychotherapeutischen Kontakt ist es wichtig, diese Ebene der existentiellen Begegnung zu erreichen. Tut man es nicht und bleibt man als Therapeut einseitig einer Therapeutenrolle verhaftet, die möglicherweise auch noch dem Credo einer Schule huldigt, geschieht es leicht, dass sich ein pseudotherapeutisches Rollenspiel einstellt, dem die zündende Intensität fehlt, mit der allein man relativ rasch tiefere Persönlichkeitsebenen erreicht. Der Therapeut soll nicht immer nur mit fachmännischer Distanz darauf warten, wohin sich der Patient entwickelt, sondern er sollte sich auch als individuelle Person ganz in der Begegnung engagieren. So kann der Patient spüren, dass er mehr als nur ein Kunde ist.
Selbstverständlich können heftige Impulse zu tiefgreifenden Persönlichkeitsentwicklungen auch Folge von Rollenkontakten sein. Sie sind es jedoch dann, wenn das Rollenverhalten an einer ungewohnten Situation, für die das bekannte Repertoire kein passendes Schnittmuster enthält, scheitert und sich damit in der krisenhaften Begegnung einer der beiden Partner als der Situation nicht gewachsen erweist. Dann kann es sein, dass der Scheiternde in eine kreative Krise stürzt, die ihn zur Neuanpassung seiner Möglichkeiten an die Realitäten zwingt. Das Verfehlen der Ebenbürtigkeit wird in diesem Ablauf jedoch offenbar. Die Gefahr einer narzisstischen Kränkung ist groß und somit auch die Gefahr, dass aus der Krise keine befreiende Öffnung zu neuen Möglichkeiten resultiert, sondern ein pathologischer Rückzug auch aus all jenen Kontakten, die dem soeben traumatisch erlebten ähneln.
Persönlichkeitentwicklungen, die durch den existentiellen Kontakt zustande kommen, passieren im Gegensatz dazu nicht, wenn der intendierte Kontakt scheitert, sondern wenn er gelingt. Sobald es zum existentiellen Kontakt kommt, werden - wie es die etymologische Analyse der Silben "mit" und mehr noch "meta" gezeigt hat - Impulse zur Verwandlung und Transformation jener seelischen Gestalten ausgelöst, die sich im gelungenen Kontakt begegnen. Im Gelingen des existentiellen Kontaktes wird gleichzeitig die prinzipielle Ebenbürtigkeit der Partner sichtbar, sodass die Gefahr einer Verletzung des Selbstwertempfindens gering ist.
Zur Ebenbürtigkeit als Strukturkriterium des existentiellen Kontaktes gehört folgerichtig auch die prinzipiell gegenseitige Offenheit für den Austausch von Impulsen. Der gelungene existentielle Kontakt ist ein symmetrisches Geschehen, sodass der Anstoß zur Weiterentwicklung stets auf Gegenseitigkeit beruht. Das Ausmaß der Veränderungen, die durch solche Kontakte ausgelöst werden, mag dabei, abhängig von dem, was der eine oder der andere später daraus macht, unterschiedlich sein, ganz ausbleiben können Veränderungen, wie im Falle reiner Rollenspiele, jedoch nicht.
Persönlichkeitsentwicklungen, die durch gescheiterte Rollenkontakte angestoßen werden, resultieren dagegen nicht aus wechselseitiger Offenheit zum Austausch, sondern aus dem mehr oder weniger traumatischen Durchbrechen einer in stereotype Verhaltensmuster geronnenen Abwehr, die zur Routinebewältigung des Alltags zwar durchaus dienlich ist, die hinter den kreativen Möglichkeiten der seelischen Reaktivität jedoch zurückbleibt. Anstöße aus Rollenverhalten bleiben fast immer einseitig, da der jeweils andere Kontaktpartner eine Position vordergründiger Überlegenheit beibehält.
Das Prinzip der Gegenseitigkeit ist es auch, das existentielle Kontakte zu einem Wagnis werden lässt. Wagnisse geht man nur ein, wenn man sich einigermaßen sicher fühlt. Die tiefergehende Sicherheit, die im existentiellen Kontakt zu erwerben ist, kann aber nur erreicht werden, wenn man oberflächlich sicherndes Verhalten aufgibt. Selbstunsicherheit und narzisstische Zweifel führen auf diesem Wege automatisch zu ihrer Stabilisierung, weil der verunsicherte Mensch gerade jene Kontakte vermeidet, die ihn langfristig sicherer machen könnten. Die Vermeidung des Kontaktes führt zu jener verunsichernden Vereinzelung, die es dem Betroffenen nahelegt, sich abzusichern und die ihm rät, dem Wagnis von Kontakten, die ihn unweigerlich ergreifen würden und die damit seine Sicherheit vordergründig untergraben, vorsichtshalber aus dem Wege zu gehen.
Kontakte finden an Grenzen statt. Sie sind Austausch zwischen innen und außen. Einerseits vermitteln sie zwischen dem Traum und dem wachen Erleben der Wirklichkeit, andererseits zwischen den verborgenen Phantasien im Innenleben des Individuums und jenen Wahrheiten, die erst im dialogischen Bezogensein erkennbar sind. Zum Verständnis der Rolle von Grenzen bei diesem zweifachen Kontaktverhalten ist es sinnvoll, zwischen der Psyche, Ich und Selbst zu unterscheiden.
Die Psyche ist das dynamische Gefüge der Bedürfnisse, Impulse und Motive, die den lebendigen Organismus und sein Umfeld teils synergistisch, teils konflikthaft konkurrierend in eine prozessuale Einheit verwebt. Die Psyche ist der virtuelle Körper eines Lebens, dessen Kontur den Leib vieldimensional durchkreuzt und umschließt. Sie hält den Leib und das Feld, in dem er lebt, in einem Zustand angespannter Differenz, sodass ein Binnenraum entsteht, der Wissen in sich sammeln kann. Je komplexer die Physiologie eines Lebewesens ist, desto mehr Psyche ist ihm daher zuzuordnen. Die Psyche ist so alt wie das Leben selbst.
Im Gegensatz dazu ist das Ich eine moderne Entwicklung. Es ist das Faktum und die Fähigkeit zur aktiven Parteinahme. Das Ich kann zu dem, was sich im Binnenraum zwischen dem Tier und der Matrix, aus der es entsteht, an Wissen sammelt, Stellung nehmen. Das Ich kann wählen und für etwas sein. Im Bewusstsein ist das Ich zunächst die Partei des individuellen Körpers und des Beziehungsnetzes, das es in dessen Interesse webt. Bewusstseinsinhalte, die sich mit dem physiologischen Schicksal des Körpers in Verbindung bringen lassen, werden vom Kleinkind zur Vorstellung einer geistig-seelischen Individualität verdichtet und summarisch als "Ich" bezeichnet.
Wie eine politische Partei, so bleibt auch das Ich dem, für den es ursprünglich angetreten ist, nicht selbstlos treu. Manchmal verfolgt es durchaus Ziele, über die sein Körper gerne noch lauter als durch psychosomatische Leiden lamentieren würde. Wenn er es denn könnte! Außerdem ist das Ich dazu bestimmt, sich von seiner Rolle als Partei des Körpers loszusagen, um in der Transzendenz zum Selbst Anwalt größerer Zusammenhänge zu werden, als es die paar Millionen Algorithmen sind, mit denen sich ein Erdenleben berechnen lässt.
Als Partei und Interessenvertreter eines Körpers, der mit anderen Körpern konkurriert, neigt das Ich dazu, Bewusstseinsinhalten, die es verdächtigt, seinen egozentrischen Impulsen entgegenzuwirken, den Zugang zu jenem Bewusstseinsfenster zu verwehren, das es selbst kontrolliert. Das unreife Ich hält unbewusst - was soviel heißt wie: es ignoriert - wovon es sich in seiner eben erst etablierten Sonderrolle gefährdet glaubt; denn von dem, was seine Bedeutung relativiert, würde es zunächst am liebsten gar nichts wissen. Als Partei eines schwachen Körpers, den es den Gefahren einer übermächtigen Welt ausgesetzt sieht, ist das Ich hauptsächlich an jenen Indizien interessiert, die ein Gefühl der Sicherheit vermitteln.
Falls es dem Ich während seiner Entstehung nicht gelingt, sich seines Wertes soweit zu versichern, dass es die Relativität dieses Wertes und sein bedeutungsarmes Huschen über die Bretter des irdischen Schauspiels gelassen hinnimmt, wird es die Aufmerksamkeit des Bewusstseins dergestalt steuern, dass sein ängstlich-überzogener Anspruch nach fremder Bestätigung nicht auf spürbare Grenzen trifft. Aus Unsicherheit beansprucht es im eigenen Bewusstsein so viel Platz, sodass weder die Welt, noch sein tieferes Selbst vom gleichsam ich-besessenen Bewusstsein unverstellt erkannt werden können. Das Resultat ist mangelndes Selbstbewusstsein, was das Problem des Ichs und seiner untauglichen Abwehr gegen den Schrecken der Flüchtigkeit weiter verstärkt.
Würde ein Ich aufhören, es für selbstverständlich zu erachten, dass es seinem eigenen Körper und sich selbst auf Kosten anderer Körper und anderer Ichs Vorteile verschafft, würde es mit seinem Selbst identisch, weil es sich dann ohne egozentrische Vorurteile selbst verstünde, wobei das Verb "verstehen" hier wörtlich verstanden wird als das Hinüberwechseln [=ver] von einem Standpunkt zu einem anderen. Der andere Standpunkt des Ichs wäre der, dass - wenn überhaupt - nur von jenem Aspekt der Individualität viel Aufhebens gemacht zu werden braucht, von dem das Individuum ahnt, dass er über den Horizont seines Ichs hinweg mit dem Kontext eines Daseins in durchdringender Verbindung steht, der sich ohne jedes Maß erstreckt und der dadurch allein imstande ist, den Sturz des Geistes aufzufangen. Diese Verbindung des Individuums in den unbegrenzten Kontext seiner Welt ist das Selbst. Und erst in dem Maße, in dem das Selbstbewusstsein steigt, bilden sich auch Selbstsicherheit und ein Selbstwertgefühl, das gegen die Anfeindungen des Daseins gefeit ist. Ein sicheres Selbstwertgefühl basiert nie auf Qualitäten, die bloß im Ich begründet sind, weil jedes Ich zu zerbrechlich ist, als dass man sich auf seine Qualitäten verlässlich stützen könnte. Dem Ich braucht man meist nur eine oder zwei seiner wichtigsten Rollen im Leben zu entziehen, schon droht der Sturz in eine tiefe Krise. Falls es nicht von einem Selbstwert aufgefangen wird.
Die Psyche bringt den Organismus in einen integrativen Datenverrechnungsbezug zum Biotop, in dem er lebt. Das Ich ist eine Funktion, die sich weniger an die physikalische Umwelt wendet, als vielmehr an ein analog gedachtes Du. Während die Kontaktaufnahme der Psyche zur Außenwelt über die Trennlinie zwischen Tod und Lebendigkeit vonstattengeht, knüpft das Ich den Kontakt zu seiner Außenwelt, indem es der Innenwelt eines Du's oder der eigenen Psyche begegnet. Das Selbst ist die Identität des Subjekts mit einer transpersonalen Wirklichkeit, der sein Ich zum Teil begegnet. Die Macht eines unerschütterlichen Selbstbewusstseins, das von Umständen nicht abhängt, fließt dem Ich zu Recht nur dann zu, wenn es als Ich Inhalte vertritt, die seinem Selbst entsprechen.
Ohne Kontakt zur Außenwelt, der ursprünglich als leibliche Geburt entstand und sich als physiologisches Erwachen aus dem Schlaf täglich als Ritual erneut vollzieht, bliebe alles, was die Psyche erleben könnte, ein autistischer Traum. Erst durch diesen Kontakt wird die Grenze zwischen dem Binnenraum der eigenen Psyche und der äußeren Welt erkennbar.
Ohne diesen Kontakt würde man womöglich im Kerzenschein einer begrenzten Vorstellungskraft endlos vor sich hinträumen. Zwar gäbe es in solch einem endlosen Traum nur wenige oder gar keine Gesetze, um die man sich zu kümmern hätte und man könnte glauben, ohne festgesetzte Grenzen sei die Traumwelt weit, tatsächlich hätte man in diesem Traum jedoch nur das begrenzte Inventar jener Möglichkeiten, die die eigene Phantasie erfindet und man würde diese Möglichkeiten immer wieder neu verknüpfen, ohne dass eine Erinnerung an die Wiederholungen bestehen bliebe. So ginge es in einem endlosen Traum wahrscheinlich immer im Kreise herum und ohne dass das Bewusstsein zu sich käme, würde es durch eine Welt von Verknüpfungen taumeln, von denen es nichts verstünde.
Würde das Erlebnis der Grenze zwischen innen und außen fehlen, wäre niemand wach. Erst indem man aufwacht, erkennt man die Grenze zwischen dem Traum und der Wirklichkeit und je besser man sie kennt, desto weniger neigt die Grenze dazu, die Psyche in ihre Begrenztheit zu verengen. Je mehr Kontakte zur Außenwelt bestehen, desto klarer wird zwar, wie eng und überschaubar die eigene Psyche ist, mit einer Enge, die man anerkennt, ist man aber bereits weiter, als wenn man von der Beschränkung nichts wüsste.
Der Austausch zwischen Traum- und Wachbewusstsein spielt, so lässt sich also vermuten, eine wenig verstandene Rolle im seelischen Dasein des Menschen, eine Rolle, die sicher weit über die bisher erreichten Versuche zur Traumdeutung hinausreicht. Die Traumdeutung selbst kann schon im Hinblick darauf, dass sich kaum jemand damit ernsthaft beschäftigt, nur als eine künstliche Facette der Interaktion zwischen dem Traum und dem Wachbewusstsein aufgefasst werden. Was die wirkliche Aufgabe des rhythmischen Grenzganges der Seele zwischen Traum und Wirklichkeit ist, bleibt im unbeweisbaren Gestrüpp von Spekulationen verborgen, dem unter der jüngsten Fußnote ein neuer Seitenzweig auswächst. Plausibel am mysteriösen Thema erscheint lediglich die Annahme, dass es zum erfolgreichen Funktionieren der seelischen Prozesse notwendig ist, dass die Grenze zwischen den beiden Bewusstseinswelten zumindest aus der Perspektive des Wachbewusstseins klar zu ziehen ist. Wer im Schlaf davon träumt, dass er sich von jetzt ab ungestraft an jeder hübschen Frau vergreifen dürfe, dem würde ein böses Erwachen blühen, wenn er im Wachzustand nicht prompt ernüchtert den traumhaften Charakter seiner nächtlichen Gesichte einsähe und wenn er von der Umsetzung dessen, was einfach nicht wahr sein kann, nicht klugerweise Abstand nähme.
Die zweite Kontaktebene zur Außenwelt, die für ein Individuum von zentraler Bedeutung ist, ist die des Kontaktes zu einem anderen Ich. Auch dieser als "existentiell" bezeichnete Kontakt funktioniert nur mit klar definierten Grenzen.
Damit sich zwei Personen begegnen können, müssen sie prinzipiell die Grenze zwischen Traum und Wachbewusstsein erkannt haben. Zum Ich-und-Du-Kontakt reicht diese Klarheit aber nicht aus. Darüber hinaus muss im wachen Zustand noch entscheiden werden, ob ein Bewusstseinsinhalt der objektiven Wirklichkeit oder der subjektiven Phantasie zuzuordnen ist. Denn ohne das kann man schlecht erkennen, was der Realität des Gegenübers und was dem Reich subjektiver Vermutungen angehört. Diese Grenze zwischen innen und außen ist die grundlegendste Form der Ichgrenze. Es geht dabei um die Unterscheidung zwischen den subjektiven Vorstellungsinhalten des wachen Bewusstseins einerseits und den objektiven Tatsachen jenseits des als abgegrenzt gedachten Individuums andererseits.
Die Entwicklung des reifen Ichs vollzieht sich als ein Prozess zunehmend richtiger Zuordnung von Bewusstseinsinhalten in die beiden Kompartimente "Innen" und "Außen". Kontakt zwischen zwei Personen entsteht in dem Maße, wie die angenommenen Ichgrenzen, die im Kontakt beansprucht und verteidigt werden, mit den wahren Kontingenten übereinstimmen, die den Ichs im Gesamtfeld der geistigen Wirklichkeit zum Zeitpunkt der Begegnung zukommen. Auf der Ebene der alltäglichen Interaktionen ist die Wirklichkeit der Zusammenhänge, die sekundär vom Bewusstsein erkannt werden können, in aktuell abgegrenzte Ichs unterteilt, wie die Oberfläche einer Kugel in konkrete Strukturen. Dort, wo die wahre Ichgrenze vom Ich irrtümlich verfehlt wird, entsteht kein Kontakt, sondern meist illusionär überdeckte Einsamkeit oder pseudopotentes Agieren. Parallel zum Auffinden seiner tatsächlichen Grenzen jedoch vertieft sich das Ich ins Selbst und wird dadurch zur echter Begegnung befähigt.
Die klassische Definition der Ichgrenze als eine Trennlinie zwischen Psyche und Wirklichkeit einerseits und dem Ich und dem Du andererseits überbetont jedoch - besonders im abendländischen Denken - den Aspekt der Eingrenzung des Ichs in einen individuellen Binnenraum. Sie verkennt, dass durch Kontakte die Begrenzungen dieser Binnenräume nicht nur aufeinandertreffen und im Aufeinandertreffen respektiert werden sollten, sondern dass durch existentielle Kontakte die Binnenräume tatsächlich erweitert werden. Dass sich die Grenzlinien also verschieben. Die Weite des Bewusstseins und der Horizont des seelischen Erlebens liegt im Individuum nicht unrealisiert, quasi verpuppt, schon vor und wird dann durch Kontakte mehr oder weniger verwirklicht, sondern der erweiterte Horizont entsteht durch die reale Begegnung tatsächlich neu. Die Welt wächst durch den Kontakt.
Insofern treffen im Kontakt nicht nur bestehende Grenzlinien aufeinander, sondern durch den Kontakt entstehen Grenzen als erweiterte Horizonte neu. Der Begriff "Grenze" hat im 13. Jahrhundert als Lehnwort aus dem Westslawischen den ursprünglichen Begriff "Mark" verdrängt. Im alten Wort "Mark", heute noch in der 'Mark Brandenburg' überliefert, wurde "Grenze" noch als "Gebiet" oder "Grenzland" bezeichnet, ja sogar als "Gesamteigentum einer Gemeinde an Grund und Boden". Grenze muss also nicht im Sinne einer scharfen Trennlinie verstanden werden, sondern sie ist auch überlappendes Territorium, das jedem nur zugänglich ist, solange es gleichzeitig auch einem anderen offen steht; oder ihm zumindest einmal offen stand. Ichgrenzen sind in Wirklichkeit nicht nur Scheidelinien zwischen dem "Entweder-Ich" und dem "Oder-Du", sondern der gemeinsame Nenner des "Sowohl-Ich-als-auch-Du". Ohne das Du fehlt dem Ich seine Grenze und ohne Grenze verfehlt das Ich seine klare Kontur.
Die Trennung zwischen dem Ich und dem Du ist im Kontakt nur ein pointierter Sonderfall. Ebenso wahr ist, dass die Ichs in ein dynamisches Feld sich überlappender Teilgebiete verwoben sind, in dem sie entstehen und ebenso wenig voneinander zu trennen sind, wie eine Welle vom Meer.
Da die eigenen Grenzgebiete unmittelbar mit fremden Grenzgebieten zusammenfallen, findet das Ich seine Grenzen und damit eine Sicherheit in sich selbst nur im realen Kontakt. Grenzen sind nicht nur Trennung, sondern Koexistenz. Sind Grenzen einmal als gemeinsame Struktur etabliert, entfällt die Notwendigkeit von narzisstischem Anspruch und Verteidigung. Im gelungenen Kontakt wird die Wahrheit berührt.
Auch für die Grenzen an der Nahtstelle des existentiellen Kontaktes gilt: je besser Grenzen definiert sind, desto durchlässiger können sie sein. Je sicherer sie sind, desto freier machen sie.
Gestört wird das Auffinden der wahren Grenzen und damit des vertieften Kontakts durch expansive Phantasien der Beteiligten, denen die Einsicht in das bescheidene Ausmaß ihrer Bedeutung schwerfällt. Im Eifer seiner Parteilichkeit für sich und seinen Körper, der ihm durch Zufall zufiel, meint das Ich gemeinerhand, es müsse sich für grundsätzlich wichtiger halten, als den Rest der Welt, weil es sonst seiner Rolle etwas schuldig bliebe. So neigt es dazu, sich in fürstliche Phantasien zu verlieren, weil die eigene Phantasie es nur allzugerne glauben macht, so viel Lohn wie die Träumerei dem Ich verspricht, könne die Wirklichkeit ihm niemals bieten. Tief im Inneren spürt jeder Mensch, dass dem Menschsein mehr zukommt, als realisiert ist. Die wahren Ansprüche, also jene, die ihm aus dem Grund des Seins heraus schuldfrei zustehen, können aber nicht offen angemeldet werden, weil das Ich in seiner Rolle als Konkurrent weiß, dass sich Konkurrenten um die Erfüllung ihrer Ansprüche beneiden. Erst dem Ich, das sich bewusst im Selbst verankert und von dort aus die Konkurrenz der Ichs als ein Gesellschaftsspiel erkennt, gelingt es angemessen mitzuspielen, ohne den Ernst des Spiels zu übertreiben.
Da meist nicht gewagt wird, die von der Wahrheit gedeckten Ansprüche an das Menschsein wahrzunehmen, geschweige denn, sie im Kontakt wirksam anzumelden, wird der Kontakt durch Verleugnung und Ansprüchlichkeit verzerrt. Statt Kontakt im eigentlichen Sinne, findet man im Grenzbereich ängstliches Sichern und Manipulation als Ausdruck einer unverstandenen Expansivität.
Die fehlgeleitete Expansivität wird auch erkennbar in der Überschätzung der dynamischen Möglichkeiten des konkreten Kontakts. Je größer das unerkannte Bedürfnis nach Expansion in die wesensmäßige Weite des Daseins ist, desto mehr wird am Beginn einer neuen Beziehung an deren wahren Möglichkeiten vorbeierwartet, was die Entstehung echter Begegnung schon im Anhub behindert und das wenige, was trotzdem wachsen kann, oft beim Umschlag in die erste Enttäuschung untergehen lässt. Vieles, was heftig beginnt, kommt zu einem raschen Ende.
Zur Struktur des Kontakts gehört nicht nur die Begrenzung seiner dynamischen Möglichkeiten, sondern auch seiner zeitlichen. Der Vereinigung liegt die Trennung bereits inne. Um Trennungen zu verhindern, kann man daher schon beim Vereinigen zögerlich sein - und umgekehrt. So wird so mancher Kontakt vermieden, um stabile Verhältnisse zu erhalten. Viele Formen gesellschaftlich vereinbarter Stabilität lassen sich nur fortsetzen, wenn man tiefere Kontakte verhindert, denn der existentielle Kontakt ist ein dialektischer Prozess, der mit der einen Hand zwar Sicherheit gibt, der mit der anderen Hand aber wieder etwas davon nimmt.
Im existentiellen Kontakt verschmilzt die Suche nach eigenen und der Respekt vor fremden Grenzen zu einem Prozess. Je besser man die Grenzen zwischen sich und dem anderen erkennt und respektiert, desto freier wird der eigene Ausdruck und desto mehr Kontakt kann man damit herstellen. Je klarer Grenzen definiert sind und je weniger umstritten, desto mehr Kontakt halten sie aus und desto durchlässiger können sie sein. Gleichzeitig werden durch die Begegnung von Grenzen scharfe Trennlinien als Hindernisse und Beengungen bereits überschritten. So werden im Kontakt Grenzen dadurch überwunden, dass man sie festlegt und sichert. Indem man um diese Begrenzungen weiß, vermeidet man es, dass die Tiefe und die Wirksamkeit des Kontaktes durch die Überladung mit falschen Erwartungen beeinträchtigt wird.
Auf einen existentiellen Kontakt kann man sich nicht nebenher einlassen, während man im Geiste mit der Reparatur eines Fahradreifens beschäftigt ist. Erreicht ein Kontakt eine existentielle Qualität, dann erfasst er zwei ganze Personen. Kontakt wird daher nicht wie eine Telephonverbindung hergestellt und bleibt dann als Selbstläufer bestehen, solange man die Verbindung nicht abbricht, sondern, wenn ein Kontakt an Intensität verliert, dann verliert man an Kontakt. So kann man zwar nicht sagen 'Alles, was intensiv ist, ist Kontakt', aber man kann sagen 'Jeder Kontakt ist Intensität'. Beim Kontakt erlischt die Verbindung, wenn ihr die Spannung fehlt, die sie begründet.
Allerdings ist zu beachten, dass die vordergründig erkennbare Erregung zweier Personen nicht notwendigerweise mit der Intensität ihres Kontaktes korreliert. Kontakt ist in solchem Maße Lebenselixier der Psyche, dass man ihn aus Angst, ihn zu verlieren oft, lieber vorgibt, als sich einzugestehen, wie schwer es fällt, sich tatsächlich auf ihn einzulassen. Daher wissen viele aus bitterer Erfahrung, dass so manches, was unter der Bettdecke geschieht, weit weniger Leidenschaft und echte Hingabe an das Königreich des Gottes Eros ist, als man als gutgläubiger Beobachter meinen könnte. So wird Intensität simuliert, weil man ahnt, dass sie das eigentlich Richtige ist. Und sie wird simuliert, weil man das als richtig Erahnte verfehlt und deshalb meint, man müsse sich die Fähigkeit zur Intensität so schnell wie möglich beweisen, um doch noch als ganzer Kerl oder echtes Weib zu gelten. Die Liebenden sind dann nicht als Leib und Seele aufeinander ausgerichtet, sondern jeder fragt sich selbstbezogen, ob er die Rolle gut spielt, von deren Erfüllung er sich Liebe und Zuwendung verspricht. Die Intensität der Erregung signalisiert hier nicht die des Kontaktes, sondern die der Angst davor, dass er misslingt.
Bei der etymologischen Analyse des Wortes "Kontakt" sind wir auf die drei Begriffe "kontra", "Tango" und "Tangens" gestoßen, die, betrachtet man sich ihre Bedeutungen genauer, auf das nahe Verhältnis zwischen dem Wesen des Kontaktes und dem der Intensität hinweisen.
"Kontra", so haben wir gesehen, enthält die erste Hälfte des Wortes "Kontakt" und benennt doch, obwohl es so mit "kon = mit" beginnt, etwas scheinbar Gegensätzliches zum verbindenden Kontakt. "Kontra" heißt "gegen" und weist durch seinen zweiten Bestandteil "-tra" darauf hin, dass "gegen" "mitter" als "mit" ist.
Will man ein Miteinander zu größerer Intensität und Spannung steigern, muss man es um jene Elemente bereichern, die dem "mit" ganz offen widersprechen. Zwar kommt Kontakt nur zustande, wenn es Kräfte gibt, die im Wunsch zu verschmelzen aufeinander zustreben, intensiver wird der Kontakt jedoch und Verschmelzung letztendlich erreichbar, wenn er auch jene Impulse in sich sein lässt, die voreinander fliehen, die sich gegenseitig leugnen oder sich sogar bekämpfen. So entsteht in jedem Kontakt, der sich nicht vor Paradoxien fürchtet, eine intensive Spannung, die die Pole, die da aufeinander treffen, stärker aneinander bindet, als es ein naives 'Ja' je könnte.
Dasselbe Bild entsteht, wenn zwei partnerschaftlich verbundene Kontrahenten miteinander Tango tanzen. Bei diesem Tanz, der mehr als alle anderen eine Choreographie des Kontaktes ist, sind die einander widerstrebenden Kräfte, die den Kontakt von der faden Gemeinsamkeit paralleler Bewegungen in das spannungsreiche Knistern eines erotischen Kampfes verwandeln, in jeder Faser der tanzenden Körper und in der Emphase des fordernden Rhythmus erkennbar.
Nicht umsonst stammt das Fremdwort "Kontrahent", das man mit "Gegner" übersetzen kann, vom lateinischen Verb "contrahere = zusammenziehen". Die Bindekraft der Gegnerschaft ist größer als die der eingespielten Harmonie, die stets synchron in dieselbe Richtung blickt und wenn die Harmonie alle Beziehungsprobleme mit sanfter Hand beseitigt hat, fragen sich die aneinandergezähmten Kontrahenten oft zu Recht, wie lange ihr Zusammenziehen so viel Gleichklang überleben kann. Im Tango verlangt das Miteinander, dass man sich nach besten Kräften gegen seine süßeste Versuchung wehrt, obwohl die Verneinung des Miteinanders weiß, dass sie doch in einem ungelogenen Kampf letztendlich überwunden werden will.
Nüchtern, wie die Mathematik sich in ihrer irdischen Form bekanntermaßen zeigt, weist ihr Tangens unbeirrbar und gelassen, so wie das, was mathematisch nun eben mal so ist, auf zwei Pole hin, zwischen denen sich die Spanne der möglichen Intensitäten des Kontaktes erstreckt. Am einen Pol hat Kontakt seine größtmögliche Intensität. Am anderen geht sie gegen Null, obwohl sich zwei mit scheinbarer Heftigkeit begegnen.
Sehr intensiv wird der Kontakt, wenn der eine Partner es, in Worten, Gesten und Taten, zulässt, dass der andere alles von ihm sieht und wenn der andere bereit ist, das, was er sehen kann, als willkommen geheißene Wahrnehmung ohne "aber" in sich gelten zu lassen. Legt man offen, was man in seinem Innenleben findet, dann reicht es dabei aber manchmal nicht, dass man schonungslos und unverhohlen über alles spricht. Denn manch eine Wahrheit ist so fein, dass sie nicht ausgesagt, sondern nur als sprachloser Ausdruck unbenennbarer Impulse getan werden kann. Um den maximal möglichen Kontakt zu erreichen, ist es außerdem notwendig, bei der Offenbarung des eigenen Ichs nichts anderes als Intensität zu intendieren. Der, der wahrnimmt ist nur dann voll im Kontakt, wenn er nichts unternimmt, um sich vor der Wucht dessen zu beschützen, was er durch die Wahrnehmung in sich als wahr annimmt.
Kaum Kontakt entsteht, wenn der eine, statt frei von Vorurteilen wahrzunehmen, was er zu sehen bekommt, es dem anderen reflexartig recht machen will und er ihm daher stereotyp zustimmt.
Kaum Kontakt entsteht auch im umgekehrten Fall; wenn man ebenso schematisch widerspricht und nichts von dem in sich gelten lassen will, was man eigentlich als richtig erkennt, weil man meint, man müsse sich auf alle Fälle selbstbehaupten.
Stark gestört ist der Kontakt natürlich auch, wenn man sich nur scheinbar offenbart und sich in Wirklichkeit belügt. Die Lüge ist ein Werkzeug, mit dem man echten Kontakt verhindern will, weil man seine Folgen fürchtet. Der echte Kontakt wird zum Schein durch falschen ersetzt und als Folge davon geht man samt der Begegnung in die Irre. Man lügt, weil jede echte Begegnung mächtig ist.
Je mehr man beim Kontakt die Wirklichkeit des faktisch unantastbaren Seins für die eigenen Zwecke vereinnahmen will, desto geringer ist seine Intensität, denn das Sein lässt nichts Halbes über seinen Abgrund verfügen. Weil das Sein die Unverfügbarkeit der Wahrheit beschützt, um weiter die reine Form seiner selbst zu sein, schwächt es die Intensität aller versuchten Kontakte, die sich zum Zwecke gezielter Nützlichkeiten dessen, was ist, bemächtigen wollen, soweit ab, bis der Versuch im Unwirklichen versandet. Die Wahrheit unterscheidet sich vom Falschen dadurch, dass man sie nicht wie das Falsche als Werkzeug benutzen kann. Immer, wenn man es versucht und sie zu einem seelischen Kommerz gebrauchen will, benutzt man nicht sie, sondern man wird von ihrem Herrschaftsanspruch selbst erfasst. Und doch erfolgt daraus die einzige Besessenheit, deren Herrschaft die von ihr versklavten Opfer in beständiger Bindung befreit. Den Willigen führt die Wahrheit Schritt für Schritt, den Unwilligen peitscht sie jeden Millimeter voran.
Da die Existenz und der Bestand des Kontaktes in so ausgezeichneter Weise mit seiner Intensität verbunden ist, tiefer noch als mit den Charakteristika "Ebenbürtigkeit", "Gegenseitigkeit" und "Begrenzung", liegt es nahe, sich den Begriff selbst näher anzusehen.
"Intensität" stammt vom lateinischen Wort "intensus = gespannt, aufmerksam, heftig". "Intensus" gehört zum Verb "intendere = hinstrecken, anspannen, seine Aufmerksamkeit ausrichten". Von dieser sprachlichen Wurzel ausgehend, finden sich heute eine ganze Reihe vielsagender Fremdwörter im Deutschen wieder.
Der "Intendant" einer Rundfunkanstalt ist eigentlich ein "Anspanner und Ausrichter", also jemand, der im Binnenbereich des Unternehmens jene Spannung erzeugt, die die Kräfte auf neue Ziele hin ausrichtet.
Die "Intention" ist eine Absicht, ein Vorhaben, eine Haltung, in der man sich im Hinblick auf das intendierte Ziel hin anspannt. Intendiert man ein Ziel, so liegt in dieser Absicht schon die "Tendenz" sich dem Ziel entgegenzuneigen, ein Hang, ein Impuls, eine Strömung in seine Richtung.
Zur Familie der teilsynonymen Verben "intendere" und "tendere" und damit zur "Intensität" gehört auch das Verb "tenere = (gespannt) halten". Vom Verb "tenere" abgeleitet sind die "Abstinenz", die "Impertinenz", die "Kontinuität", sowie die Wörter "Tenor" und "Tenor".
So fällt es leicht bei der Abstinenz, also dem aktiven Abstandhalten vom Dämon Alkohol, die Anspannung zu erkennen, die darin liegen kann, das Sich-Hinstrecken zur lichten Seite des Lebens und die Aufmerksamkeit, die im nüchternen Zustand dem Dasein gegenüber ebenso möglich ist wie der Aufgabe, es von toxischen Trübungen frei zu halten. Es sind also alle drei Übersetzungen des Verbes "intendere" ohne Mühe aus dem Thema "Abstinenz" herauszulesen und man braucht nicht viel zu wagen, wenn man sagt, dass Ursprung und Motiv der Süchte in der Vermeidung intensiver Kontakte liegt.
Impertinent wirkt, wer sich beharrlich mit Bemerkungen einmischt, die mit der infrage stehenden Sache gar nichts zu tun haben. Statt sich unpassend in das Thema einzumischen, über das man sich gerade spannend unterhält, sollte sich der Impertinente besser ganz heraushalten.
Bei der Kontinuität springt der Zusammenhalt des Kontinuierlichen so direkt ins Auge, dass weitere Erläuterungen des Begriffes überflüssig sind.
Wenn eine Aussage zur Sache im gleichen Tenor erfolgt wie die bisherigen, dann meint die Sprache damit, dass derselbe atmosphärische Sinnzusammenhang, um den sich die bisherigen Aussagen scharen, auch vom neuen Beitrag eingehalten wird. Im gleichen Tenor spricht, wer den Rahmen einhält, der vorgegeben ist.
Der Tenor schließlich soll als Hauptstimme ohne Zittern das Kathedralendach des Opernklanges halten.
In allen zitierten Abkömmlingen des Verbes "tenere" ist das ursprüngliche "halten" zu finden. Forscht man weiter in der Ahnengalerie indoeuropäischer Wörter, findet man als Vorfahren des "tenere" und des "tendere" das Urwort "ten = dehnen, ziehen, spannen", das geradlinig darauf hinweist, dass zum Sinnkreis des Haltens und Spannens auch das "Dehnen" gehört.
Für die Untersuchung der Tiefenstruktur des Kontaktes ist ein naher Verwandter des "Dehnens" bedeutsam. Es handelt sich dabei um das Wort "gedeihen", dessen etymologische Wurzeln sich bis in die widersprüchlichen Bilder des Dehnens und Sich-Zusammenziehens erstrecken, und das somit nachweist, dass das Gedeihen ein dialektisches Wechselspiel aus Kontraktion und Expansion erfordert.
Ohne die Intensität wechselnder Kontakte, die den Horizont des Interesses in das nähere Umfeld ausdehnt, würde sich das Ich durch die Gravitationskraft seiner individuellen Egozentrik auf eine ausweglose Enge innerhalb der eigenen Grenzen beschränken. Oberflächliche Kontakte haben dabei kaum die Kraft, das Ich aus einem angestammten Schwerpunkt heraus und in eine neue Bewegung zu bringen, da widerstrebende Kräfte, die der Bewegung entgegenwirken und Anwälte des Beharrens sind, es gelernt haben, schwache Impulse in ein Netzwerk abwehrender Routinen einzuspeisen, wo dann rasch auch noch das wenige an Schwung, mit dem sie kamen, im viskösen Puffer selbstverständlicher Gewohnheiten verschwindet. Deshalb ist es die Aufgabe des Therapeuten im Kontakt mit dem Klienten, der in den gewohnten Mustern seiner Neurose sitzt, eine möglichst intensive Begegnung zu suchen. Intensität braucht dabei aber nicht mit spektakulärer Heftigkeit gleichgesetzt zu werden. Intensiver als ein Strohfeuer, das seine Kraft sofort verbrennt, ist oft die unbeirrbare Beharrlichkeit der Wiederholung, die die nötige Spannung, die zur therapeutischen Wirksamkeit gehört, solange hält, bis sie reif ist zur Entladung.
Die Intensität des Kontaktes wird durch die Begriffe "Dehnen", "Spannung" "Halten" und "Aufmerksamkeit" benannt. Selbst wenn man mit entspannter Aufmerksamkeit den Kontakt geschehen lässt, so wie er sich seinen Gesetzen gemäß entwickelt, gründet die Präsenz, die bei der Begegnung erforderlich ist, darin, dass man unter dem entspannten Dasein eine präsente Spannung hält. Schon von daher, ist gerade der intensive Kontakt nur vorübergehend möglich. Er muss durch Phasen des Rückzuges unterbrochen werden. Wem es gelingt, eine Beziehung zwischen entschiedener Begegnung und angstfreiem Rückzug pulsieren zu lassen, hat eine große Chance, dass sich sein Horizont dehnt und er selbst gedeiht. Rückzug und Kontakt bilden den Pulsschlag des Denkens.
Bei den Mitgliedern eines Löwenrudels handelt es sich um Individuen. Die Löwen bilden durch soziale Interaktion einen Verband, dessen Binnendynamik von den Tieren ausgefochten wird und der durch die so gewonnene Ausgestaltung einer Rudelstruktur nach außen abgegrenzt ist. Der Verband ist eine intern konkurrierende Symbiose von dynamisch variablen Elementen und bildet eine eigene Gestalt. Die Struktur des Verbandes scheint dabei weitgehend durch den Kontakt zum umgebenden Biotop und durch instinktive Verhaltensmuster geprägt zu sein. Die Verhaltensmuster variieren im Rahmen des genetisch vorgegeben Verhaltensrepertoires der Spezies Löwe und werden von den kybernetischen Gesetzen hierarchischer Ordnungen moduliert. Diese ihrerseits sind vom Nutzen symbiotischer Synergien und den Regeln konkurrierenden Kräftemessens bestimmt.
Das Kontaktverhalten der Löwen im Rudel erfüllt zwei Funktionen: Es orientiert das einzelne Tier über seine Position im Verband und es gibt durch die Einbindung in das Rudel Sicherheit. Junge Löwen testen durch spielerische Rangeleien aus, wo ihr Platz im Rudel ist. Ist der Platz gefunden, lässt die Intensität ihres Interaktionsverhaltens nach und der Kontakt zu den Gruppenmitgliedern dient von da ab weniger der Erkundung, als vielmehr der Einordnung im Verband.
Löwen scheinen jedoch über die Angelegenheit nicht bewusst nachzudenken. Man hat zwar den Eindruck, als nähmen sie sich bei ihren Interaktionen jeweils als fremdes Gegenüber wahr. Es sieht aber nicht so aus, als würden sie nach der erfolgten Wahrnehmung des anderen in bewusster Reflektion entscheiden, welche Haltung sie selbst bei der Begegnung einnehmen möchten. Trotzdem sind Löwen keine seelenlosen Apparate. Auch im Löwen spielen sich je nach Situation Ambivalenzkonflikte zwischen widerstrebenden Impulsen, Impulsen zu Angriff oder Rückzug, ab und es gibt keinen Grund, warum man dieser Dynamik nicht auch entsprechende Affekte zuordnen und dem Löwen damit eine Psyche zusprechen sollte.
"Affekt" heißt eigentlich das "Hinzugetane" bzw. das "Dabeigemachte". Der Affekt ist ein Steuerimpuls, den das Subjekt der komplexen Situation zur gezielten Einstimmung auf individuelle Zielsetzungen hinzufügt. Mit der Stimmung stimmen sich der Handlungsablauf der organischen Struktur, die Wahrnehmung und die Realität des subjektiven Wunschgenerators aufeinander ab. Spricht man dem Löwen folglich Affekte zu, dann impliziert dies die Existenz einer "Löwenperson", deren Wunsch und Wille durch die Maske des Löwentieres hindurchtönt, denn wenn etwas "hinzugetan" wird, muss jemand da sein, der das macht. Ob die Existenz der Löwenperson der des Tieres vorangeht, ist damit nicht gesagt. Es könnte auch sein, dass sie erst als Brennpunkt der komplexen Lebenssequenz "Löwe" entsteht. Die Brennweite einer Sequenz, die Distanz die man also braucht, um ihre Struktur zu erkennen, hängt von ihrer Komplexität ab und entspricht der Tiefe der geistigen Dimension, die als Erkenntnis ausgelotet wird. Man kann daher vermuten, dass der Löwe vom Menschen nur wenig erkennt, weil der Mensch zwar einiges vom Löwen, der Löwe aber nur wenig vom Menschen enthält.
Richtige Entscheidungen für das Überleben, Entscheidungen über die Frage nach Angriff oder Rückzug kann das Zentralnervensystem des Löwen nur treffen, wenn es vor der Entscheidung mit Hilfe aktueller Sinnesdaten verschiedene Handlungsabläufe simuliert und die Ergebnisse der Simulation mit abgespeicherten Varianten möglicher Handlungssequenzen vergleicht. Das Zentralnervensystem des Löwen ist ein Wirklichkeitssimulator und ohne dass er etwas davon merkt, ist es ohne Zweifel so, dass das Gehirn des Löwen im Schatten eines fehlenden Ich-Bewusstseins durchaus denkt.
Da die Löwen aber mögliche Verhaltensvarianten nicht bewusst gegeneinander abwägen, um durch bewusste Wahl zu entscheiden, welche sie für die richtige Variante halten, geschieht ihr Verhalten, ohne dass sie es geschehen lassen müßten und die Affekte und Emotionen, die das Verhalten vermitteln, bleiben ebenso unbewusst, wie die kognitiven Simulationen ihres Gehirns.
Das Verhalten der Löwen konstituiert sich vornehmlich als eine Motorik ihrer Körper. Die leibliche Motorik wird vom psychischen Phänomen der Emotionalität nahtlos begleitet. Welche Körperbewegungen der Löwe macht, hängt von der jeweiligen Emotion (emovere = herausbewegen) ab, die den Löwen als Resultat seines Denkens aus jener anorganischen Passivität herausbewegt, in der er ohne die Informationsverarbeitung seines Gehirns verharren würde; ohne dann noch ein wirklicher Löwe zu sein. Bewusst wird sich der Löwe aber nicht, da er selbst zu seinen Emotionen nicht Stellung nimmt. Sein Denken bleibt eine emotive Motorik, die ihn bewegt, aus der er sich selbst jedoch nicht herausbewegen kann. Bewusst wird ein Denken im Gegensatz dazu, wenn seine Resultate nicht nur spontan eine Bewegung von innen heraus bewirken, sondern wenn die Zentrierung des Prozesses nach außen verlagert und der Prozess dadurch von außen her verstanden wird. Das reine Bewusstsein befindet sich außerhalb der Körper, in deren Innerem es die Psyche Wahrheitshypothesen simulieren lässt. Gott versteht sich aus der Welt und kann sie von außen betrachten.
Den Löwen wird nicht bewusst, dass sie eine Psyche haben, in der es denkt und fühlt. Da nicht das einzelne Tier über sein Verhalten entscheidet, sondern das Resultat seiner Phylogenese, brauchen die Löwen kein Ich, das bei "falschen" Entscheidungen unter Selbstzweifeln zu leiden hätte.
Auch das Wort "Ich" benennt im Regelfall einen Verband konkurrierender Strebungen, die gleichzeitig als symbiotisches Interessenbündnis zum gegenseitigen Nutzen ineinander verwoben sind. Was vom Organismus Mensch als "Ich" etikettiert wird, hängt zum großen Teil von unreflektierten Annahmen ab. Offensichtlich besteht zwischen dem Bewusstsein und dem Ich eine zentrale Verbindung. Das Ich wird einerseits im Bewusstsein sichtbar, andererseits kann das Ich das ihm Bewusste für seine Zwecke verwenden. Meist setzt sich das Ich jedoch nicht mit dem Bewusstsein gleich, sondern identifiziert sich mit allerlei Elementen, die es innerhalb oder außerhalb seiner Psyche im Lichtschein des Bewusstseins entdeckt. So sagt es zum Beispiel 'Ich bin müde', 'Ich bin der Besitzer eines Zweitwagens' oder 'Ich bin Dein Vater'. Je nach Situation definiert es sich also anders. Pauschal kann man in etwa sagen: Je reifer ein Ich wird, desto abstrakter sind die Phänomene, mit denen es sich gleichsetzt. So spiegelt sich in dem, was das Ich in seinem Werden macht derselbe Vorgang, durch den es wird. Das Ich entsteht aus der Substanz.
Eine erneute Stippvisite im wundersamen Reich der Etymologie lässt verstehen, was man sich unter unbewusstem Denken und Fühlen vorstellen kann. Das Wort "bewusst" besteht aus zwei Teilen. Erstens der Silbe "be = versehen mit", also einer Kurzform des Wortes "bei". Der zweite Teil führt über das Verb "wissen" zur indoeuropäischen Wurzel "ueid = sehen". Die bewusste Wahrnehmung ist also eine "beigesehene" Wahrnehmung.
Der Löwe, der träge unter seiner Akazie liegt und in die flirrende Mittagshitze blinzelt, nimmt die Situation mit seinen Sinnen durchaus wahr. Er setzt die diversen Eindrücke seinen Augen und Ohren, der Nase, des Tastsinnes, der Wärmeempfindung und der Binnensensoren, so wie wir, zu einem gestalteten Modell der Wirklichkeit in sich zusammen. Im Gegensatz zu uns sieht der Löwe diesem Bild aber nichts bei. Da er nichts beisieht, wird ihm das Bild nicht bewusst. Sein Denken besteht daraus, dass sein Gehirn die organismische Logik, die aus der Binnendynamik des Bildes zwingend hervorgeht, mit Schablonen vergleicht, die im Gedächtnis vorliegen. Das Resultat des Vergleichs wird unmittelbar als Verhaltensergebnis ausagiert. Das Denken des Löwen zielt unmittelbar nach außen, ohne das die Zentrierung des Denkens dorthin verlagert wird. Überwiegt zum Beispiel die Trägheit den Hunger und sind die Zebras zu weit weg, bleibt der Löwe einfach liegen, ohne das ihn wegen seiner Faulheit von irgendwoher ein Gewissen plagt.
"Bewusst" ist eine Wahrnehmung, wenn dem Bild der Sinne simultan etwas "beigesehen" wird, was mit den Sinnen aktuell gar nicht wahrgenommen werden kann. Der Löwe sieht die Zweige der Akazie im sengenden Savannenwind vibrieren. Der Löwenforscher, der die Szene vom sicheren Wagen aus betrachtet, sieht das Vibrieren auch. Ihm wird das Vibrieren jedoch bewusst, weil er dem sichtbaren Phänomen etwas Virtuelles beisieht, zum Beispiel: 'Wenn der Wind ungünstig steht, wird der Löwe mich riechen' oder 'Laura aß zum Frühstück danach am liebsten Brötchen mit Akazienhonig'.
Nota bene: auch der Löwe kennt das Problem des ungünstigen Windes. Wenn er den Wind jedoch spürt, denkt er nicht 'Das Zebra wird mich riechen', sondern der Löwe denkt bloß 'Bei diesem Wind laufen die Zebras wahrscheinlich weg'. So kommt man schon wieder zum Ich. Das Ich ist ein zentrales Symbol, das der Wahrnehmung beigesehen werden kann, damit ein konstantes Bewusstsein entsteht. Das Ich ist ein abstraktes Faktum, das mit keinem Sinnesorgan wahrgenommen werden kann und das somit nur in dem Bewusstsein besteht, dessen Bestand es von innen heraus selbst erschafft und das es sich wie ein Haus ohne Wände immer weiter ausbaut. Das Bewusstsein entsteht aus der Beisicht von Dingen, die das Auge nicht erfassen kann. Der Löwenforscher denkt an Laura und wie sehr es ihn reut, in Mombasa nicht in dem Moment vom Zug abgesprungen zu sein, als er im Auge dieser Frau mit Gewissheit sah, dass er ohne den Sprung aus dem Zug die Erde für immer verlassen wird. Das Denken des Löwen über die Entfernung der Zebras ist, dass er unter der Akazie liegenbleibt. Er denkt nicht, dass er liegen kann, sondern dass er liegt, ist was er denkt. Kurz: Der Löwe tut, was er denkt.
Das menschliche Kontaktverhalten erfüllt wie das der Löwen zwei Funktionen. Es dient der Orientierung und der Sicherheit. Im Gegensatz zum Löwen aber, dessen Verhalten nicht im Interesse des einen individuellen Exemplars, sondern im Interesse seiner Spezies von der Stammesgeschichte gesteuert wird und dessen Verhalten daher artzentriert auch ohne sein bewusstes Zutun geschieht, hat der Mensch ein Ich, das als Anwalt des einzelnen Individuums in den Gang der Dinge eingreift, der ohne die Entscheidungen des Ichs spontan aus der Interaktion seiner Psyche mit der Umwelt heraus geschehen würde.
Damit das Ich aber in seinem Interesse, also egozentrisch, entscheiden und parteiisch eingreifen kann, braucht es Informationen, die nur ihm unmittelbar zugänglich sind und die sich aus seiner unverwechselbaren Perspektive auf die Dinge ergeben. Dabei handelt es sich um Informationen, die sich nicht auf eine biologische Interaktion des Organismus mit seiner Umwelt beziehen, sondern auf eine soziale Interaktion mit diversen Du's. Da die Du's, auf die das Ich treffen wird, pränatal nicht vorherzusehen sind, kann es einen großen Teil der nötigen Informationen nicht genetisch verankert mitbringen, sondern es muss sie postnatal sammeln. Die Informationen, um die es geht, findet es durch den Kontakt. In seiner Funktion als Partei eines Körpers, der nicht nur wie der Körper des Löwen im Auftrag der Stammesgeschichte mit anderen Löwenkörpern um die besten Plätze in der Löwensymbiose konkurriert, sondern es darüber hinaus auf eigene Rechnung tut, braucht das menschliche Ich mehr Informationen als ein Löwenjunges, um seinen Platz und damit seine Identität zu finden. Deshalb sucht der Mensch im Kontakt mehr, als es ein Löwe tut, nach Neuem. In der reinen Sicherheit kann der Mensch nicht ruhen, ohne dass er durch diese Behäbigkeit an eigentlich menschlicher Lebendigkeit verlöre. Ein gesunder Mensch kann auf Dauer nicht den ganzen Tag verdösen, so wie es gesunde Löwen durchaus tun.
Während bei Tieren das explorative Element des sozialen Kontaktes gegenüber dem sichernden Element zweitrangig bleibt und mit dem Erwachsenwerden fast verschwindet, sind Sicherheit und Erkundung des Neuen durch Exploration beim zwischenmenschlichen Kontakt zumindest gleich wichtig. Je intensiver die Begegnung zwischen einem Ich und einem Du wird - und je spezifisch menschlicher sie daher ist - desto mehr rückt die Exploration des bisher unentdeckten Neuen in den Vordergrund.
Von daher kommt die Hypothese: Intensiver Kontakt ist explorativ. Durch den Kontakt möchte man sein Umfeld erkunden. Die Impulse zur Kontaktsuche richten sich am leichtesten dorthin aus, wo es etwas Neues zu entdecken gibt. Ist eine Möglichkeit erkundet, lässt das Interesse daran nach. Der Kontakt zwischen zwei Menschen ist daher nur solange in hoher Intensität aufrecht zu erhalten, wie beide im jeweils anderen etwas Neues entdecken können. Intensiver Kontakt besteht, wenn man sich bei der Begegnung gegenseitig ertastet. Der Kontakt lässt nach, wenn man meint, den anderen zu kennen; wenn man also glaubt, man müsse ihn von nun an nicht mehr ertasten, sondern man habe ihn bereits begriffen. Statt noch im wirklichen Kontakt mit dem Gegenüber zu sein, bezieht man sich auf die Begriffe, die man sich vom anderen macht. Oftmals ohne dass man sich darüber Rechenschaft ablegt, begegnet man nicht mehr der wirklichen Realität, sondern jenen inneren Bildern, die man zu den Begriffen assoziiert. Das scheinbar Bekannte lebt nebeneinander her. Das tatsächlich Bekannte spielt sich aufeinander ein, sodass auch hier die Intensität der Begegnung nachlässt.
Wirklicher Kontakt fordert dazu heraus, das eigene Innenleben, das Reich der unverbindlichen Vorstellungen und Phantasien zu verlassen, um stattdessen in der Realität wirklich zu sein. Statt sich vom Fremden dazu herausfordern zu lassen, dass man es ertastet und berührt, bleibt man jedoch oft zu lange mit ihm in vorsichtig zurückhaltender Konkurrenz. Von dort aus ertastet man nicht vorbehaltlos, sondern taxiert, inwieweit das Ertastbare dem Eigeninteresse förderlich erscheint. Oft hält man sich endlos mit der Überprüfung auf. Statt dass man im Kontakt lebendig wird, bleibt man hinter ihm in stummer Einsamkeit zurück.
Da es zum Wesen des reinen Kontaktes gehört, Unbekanntes zu erforschen, kann sich die therapeutische Wirksamkeit nur ungestört entfalten, wenn man die Psychotherapie nicht als applizierbares Verfahren begreift. Soweit ein Kontakt nicht original und existentiell echt ist, wird er nur simuliert. Je austauschbarer ein Kontakt ist, desto weniger findet er tatsächlich statt. Da Kontakt immer nach dem Neuen sucht und das Neue auch neue Kontaktformen erfordert, lassen sich Kontaktformen nicht auf Dauer konservieren, ohne dass die Intensität des Geschehens darunter litte.
Die Herausforderung, dem Neuen zu begegnen, setzt das Ich unter Leistungsdruck. Es wird dazu herausgefordert, aus sich herauszutreten und dort draußen einer Existenz zu begegnen, in der es als Teil einem unbeherrschbaren Ganzen ausgeliefert ist. So kommt das Ich notwendigerweise in eine paradoxe Situation. Angetreten als Anwalt von Parteiinteressen, die an seinen Körper gebundenen sind, muss es in Erfüllung dieser Aufgabe nach Informationen suchen, die es nur erhält, wenn es aus sich heraustritt und wenn durch sein Heraustreten aus der punktuellen Perspektive seiner körperlichen Individualität erkennt, dass seine Parteilichkeit eine Verengung des Blickwinkels ist.
Die paradoxe Situation, in die das Ich bei der Erfüllung seiner Aufgabe gerät, dass es zu ihrer Erfüllung von ihr absehen muss, ist ein pointiertes Beispiel jener Widersprüchlichkeit, die man im Kontakt in unterschiedlicher Weise zu gegenwärtigen hat. Vieles, dem das Ich bei seiner Erkundung der Umwelt begegnet, schwingt ständig im Takt verschiedener Rhythmen. Was heute warm erscheint, kann morgen bitterkalt sein.
Erst im kontinuierlich gehaltenen Kontakt oder in dem, der sich beharrlich wiederholt, wird die Koinzidenz des Gegensätzlichen zur Erkenntnis einer ganzen Wahrheit integriert. Nur so wird erkannt, dass das Gegensätzliche - zum Beispiel die Kälte des Eises und die Hitze des Wasserdampfs - nicht nur in der empirisch erfassbaren Welt zufällig koexistiert, sondern so zum Wesen des Wassers gehört, dass die Gegensätzlichkeit diesseits der Sinne nachgerade auf einen gemeinsamen Schnittpunkt jenseits des Sinneshorizontes zielt. Wasser wird schließlich immer nur in einem Temperaturbereich erlebt, der im Gegensatz zu den anderen Bereichen steht. Daher ist das Wesen des Wassers der gemeinsame Nenner widersprüchlicher Aspekte.
In Analogie zu diesem Beispiel ist auch sonst nichts erkennbar, was nicht im Gegensatz zu etwas anderem stünde und mit der Integration all dieser Unterschiede zu einem stabilen Bild, mit dem es überhaupt erst etwas anfangen kann, ist das Ich beschäftigt, sobald es mit seiner Welt in Kontakt kommt; und solange, bis es sie wieder verlässt.
Gegensätze, die verschiedene Objekte auszeichnen - zum Beispiel dass Ameisen klein und Elefanten groß sind - sind für das werdende Ich, das aus dem Dämmerschlaf seiner organischen Ursprünge langsam erwacht, noch leicht zu verdauen.
Etwas mehr stutzt es, doch auch nicht sehr lange, wenn dieselbe Sache - kaltes und warmes Wasser - jetzt so und so sein kann, obwohl sie eben noch ganz anders war. Die Zeit und das schillernde Kaleidoskop ihrer Verwandlungen, so sagt sich das Ich, macht den Wechselschritt im Tanz der Dinge möglich.
Merkwürdiger noch als das bisher Genannte, in dem das Ich sich mit etwas Übung gut orientieren kann, empfindet es die anderen Ichs und damit auch sich selbst. Nicht nur, dass es zu unterschiedlichen Zeiten von verschiedenen Wünschen, Gefühlen und Impulsen bestimmt wird, sondern in jedem einzelnen Augenblick ist das Ich, wenn es sich daran macht und nach der Bedeutung seiner Haltungen und Motive forscht, bereits in verwirrender Weise polyvalent. Nichts am Ich erscheint so eindeutig festgelegt, dass es an der Allgemeingültigkeit einer psychologischen Deutung keine Zweifel mehr gäbe. Kein Symptom, das eine Seele plagt, lässt sich aus einem einzigen Blickwinkel heraus vollständig erklären. Alle Tiefenpsychologie kommt daher zur Erkenntnis: 'So ist es, und so ist es, und anders ist es auch.'
Mit welchen Problemen das Ich bei der Selbsterkenntnis zu kämpfen hat, kann man sich durch ein amüsantes Gedankenexperiment deutlich machen. Man stelle sich vor, Autos wären hinsichtlich ihrer Eigenschaften nicht stabil, sondern unterlägen - wie ihr vollständiger Name "Automobil" es interpretieren ließe - einem steten Wandel. Montags verlässt man das Haus und besteigt einen dunkelblauen Wagen französischer Bauart mit Heckklappe und Dieselmotor. Während des Arbeitstages bekommt das Ding ein Stufenheck. Am Dienstag schimmert das Blau grünlich und unterwegs stellt man verwundert fest, dass die Rückbank fehlt und man in einem englischen Roadster durch die Gegend fährt. An der Ampel steht in der Reihe nebenan eine süße Blondine im roten Cabrio mit Ledersitzen und lolitaluderfarbenem Lidschatten. Die Zahl der eigenen Zylinder steigt jetzt auf sechs bis acht. Am Armaturenbrett bildet sich der Tourenzähler. Mit den Lippen lächelt man souverän der Blondine zu und der Fuß tippt spielerisch ans Gaspedal. Schon brummt es sonor unter der bebenden Haube! Da springt die Ampel frech auf grün, der Fuß gibt lässig Gas, doch statt dass der blöde Schlitten richtig spurt, verwandelt er sich blitzschnell in einen Lieferwagen. Das alles wäre nicht so schlimm, denn mit derlei Überraschungen bei der Autofahrt hat man sich zwischenzeitlich weise abgefunden. Doch ärgerlich wird man dann doch, wenn man abends zum Parkplatz kommt, auf dem man morgens den Lieferwagen abgestellt hat. In der Zwischenzeit hat er sich so verändert, dass man nicht mehr weiß, ob der eigene Fahrzeugschein nun zur lila Rostlaube oder zum gelben Kombi gehört.
Hat man an diesem Beispiel die Berg-und-Tal-Fahrt erkannt, die das Ich bei der Bildung eines Selbstbildes durchleidet, kann man sich denken, dass es sich manchmal danach sehnt, ganz einfach "genauso" und nicht "anders" zu sein. Hat es den Eindruck, als wüchsen ihm mehr Gegensätze zu, als es schmerzfrei zu integrieren im Stande ist, wird es manchmal trotzig und tut so, als hätte es mit einigen Gegensätzlichkeiten gar nichts zu tun. Wie Vogel Strauß steckt es den Kopf in den Sand. Nach dem Motto 'Dass nicht sein kann, was nicht sein soll' nimmt es das, was es nicht sehen mag, nicht mehr wahr. Die Verdrängung ist geboren.
Als entstünden aus der Polyvalenz der Partner im Kontakt nicht schon Probleme genug, kommt noch dazu, dass in der Dynamik des Kontaktes selbst je nach Kontext und Zeitpunkt in unterschiedlicher Art zwei schwer vereinbare Pole am Werke sind: Indem Kontakt sich intensiviert, spielt er mit seinem Ende. Aus der Erfahrung weiß man bald, dass gerade die intensivsten Freuden der Liebe nicht zu konservieren sind - obwohl man doch ganz sicher war, dass man das gefundene Paradies nur noch durch das Werk boshafter Kräfte von außen verlieren könnte.
Im Kontakt liegt die Tendenz zur Steigerung seiner Intensität, indem ein erstes Anknüpfen assoziativ nach seiner Erweiterung drängt. Ergibt sich bei einer zufälligen Begegnung - in der U-Bahn oder der Warteschlange im Supermarkt - ein Blickkontakt, neigt die Dynamik des Kontaktes dazu, diese erste Berührung durch ein Lächeln oder zumindest ein freundliches 'Hallo' zu vertiefen. In unseren Breiten beginnt hier jedoch häufig das Ich, sich bereits in die gegenläufige Tendenz zu versteifen. Gehemmt von einem vagen Gefühl der Schüchternheit blickt es eilig in die nächste Ecke. Vordergründig befürchtet es, bald nicht mehr weiter zu wissen und betreten dazustehen, falls es sich jetzt noch einen Schritt weiter hinaus aus dem sicheren Gehege seiner vorgefassten Ziele und hinein in den Fahrtwind der Begegnung wagt. Dass die grundlegenden Muster sozialer Primatenkontakte jedoch genetisch verankert im Fundus der Psyche bereitliegen und man eigentlich das Natürliche nur geschehen lassen muss, zeigt die Beobachtung unverdorbener Kinder, zumindest sobald sie das entwicklungsbedingte Fremdeln überwunden haben. Auch Kinder vermeiden zwar durchaus Kontakte, aber nicht weil sie glauben, die zu vermeidende Gefahr liege in ihnen selbst, sondern so, wie Erwachsene sich vor einem freilaufenden Nashorn fürchten.
Erst wenn in der Psyche des Kindes ein Ich installiert ist, das erkennt, wie man der Welt ein privates Gehöft abtrotzen kann, in dessen Abgeschiedenheit es sich einer kleinen Willkür frönen lässt und erst, wenn in der Psyche dieses Ich sich daran macht, die eigenen Pfründe zu behüten, wenn das Kind also gelernt hat, zwischen den eigenen und den fremden Interessen zu unterscheiden, kommt die erwachsene Kontaktangst auf. Im Zuge seiner Parteilichkeit glaubt das Ich, dass seine Rivalität mit den anderen nicht im Dienste eines gemeinsamen Ganzen steht, sondern dass es selbst ein Ganzes ist, dessen scheinbare Autonomie es gegen den Neid der Konkurrenten zu erhalten gilt und dessen brüchige Stellen im nahen Kontakt wie Siegfried`s Schwachstelle sichtbar würden. Die vordergründige Angst, nicht mehr weiter zu wissen, sobald man sich der Wellenbewegung des Kontakts überließe, verdeckt die tiefere Befürchtung, im Kontakt zu verlieren, was das Ich für sein Parteivermögen hält.
Doch in der dynamischen Struktur der Kontakte liegt nicht nur die Tendenz zu ihrer Steigerung und damit der Grund für die Angst, dass man sich selbst darin verliert, sondern mit der Steigerung verbunden ist auch der Keim ihres Endes. Neue Kontakte werden vermieden, weil sie das Ende der alten einläuten könnten. Bestehende Kontakte werden auf Sparflamme gelebt, denn wenn man ihre Intensität nicht künstlich drosselt, wird ihr Feuer jene Strukturen bedrohen, in denen man sich sicher fühlt. Ein einziger unkontrollierter Kontakt kann unter Umständen ein sorgsam gepflegtes Gebäude sichernder Beziehungen so kläglich zum Einsturz bringen, wie einst Sorbas' Baumrutsche auf der griechischen Insel zusammenbrach.
So ahnt das Ich, und es handelt entsprechend, dass jeder echte Kontakt ihm nicht nur neue Möglichkeiten bringt, sondern auch ein Opfer von ihm fordert. Je mehr es sich auf die Wirklichkeit einlässt, und je mehr Aspekte es daher bei seinem Kalkül berücksichtigen kann, desto mehr schwindet seine Bindung an sein einseitiges Parteistatut. Durch neue Kontakte wird Neues ins Weltbild des Ichs integriert, wodurch das Ich an Integrität gewinnt. Begegnet man Menschen mit hoher Integrität, bemerkt man, dass sie nicht mehr ihrer egozentrischen Parteilichkeit unterworfen sind - obwohl das durchaus nicht heißt, dass sie sich selbst aus den Augen verloren haben. Statt weiter dem illusionären Ziel einer persönlichen Autonomie hinterherzujagen, zu deren fragwürdiger Mitgift es gehört, dass ihre Grenzen misstrauisch gegen alles verteidigt werden müssen, was sich dem Anspruch nach Autonomie nicht beugt, befasst sich das reife Ich mit der Integration auch jener Aspekte der Wirklichkeit, die ihm jeweils als Antithesen entgegenstehen. Ziel dieser Integration ist eine persönliche Integrität, bei der jene Teile der Realität als gleichwertig ins Selbstbild des Ichs reintegriert sind, die es in der Anfangsphase seiner Entstehung als "ichfremd" ausgegrenzt hatte. Im Stadium der Integrität unterlassen die widersprüchlichen Teilaspekte der Psyche den Zugriff aufeinander, weil sie jene Beziehung gefunden haben, die mit dem Ganzen stimmig ist.
Die Integralrechnung ist eine kluge Erfindung der Mathematiker. Sie dient dazu, Flächen unter geometrischen Kurven zu ermitteln. In infinitesimaler Annäherung werden dabei Teilflächen aufsummiert. Da der mathematische Fachbegriff "Integral" mit der anthropologischen Größe "Kontakt" sprachlich verwandt ist, sei es erlaubt, das mathematische Geschehen als Metapher dessen zu sehen, was dem bewussten Ich im dynamischen Feld seiner wechselnden Kontakte geschieht: Das Ich wird zum Aussichtspunkt der Bezüge, mit denen es Kontakt aufnimmt, aufintegriert, sodass es sich vom Aussichtspunkt des Integrals aus selbst erkennt. Indem es erkennend das Muster der Bezüge seiner Lebenswelt zu einem konsistenten Bild integriert, wird es zur geistigen Ebene von deren Integration. Der Geist ist der gemeinsame Treffpunkt aller Dinge, in dem sie sagen 'Wir sind Du selbst'.
Eng verbunden mit der Vorstellung der Integration findet man das Motiv der förderlichen Solidarität. Man kann sich nur dann in ein Ganzes fügen, wenn man das Ganze, in das man eingeht, grundsätzlich begrüßt. Reiner Kontakt in vertiefter Form gelingt nur, wenn man sich in gegenseitiger Bejahung begegnet. Nur wer für den anderen ist und bereit, sein Fortkommen zu fördern, kann ihn vorbehaltlos berühren und ihm, ohne dass er ihn dadurch beherrschen könnte, Impulse beirühren, die ihm nützlich sind. Vorbehaltlos kann der eine das Fortkommen des anderen nur bejahen, soweit dessen Ich sein eigentliches Interesse nicht mehr in einer einseitigen Parteinahme erkennt, nicht mehr in der Konkurrenz und im Wettlauf um die besten Plätze, sondern im reinen Interesse (= dazwischen-sein) selbst. Erst wenn sich zwei Ichs darin einig sind, dass ihr gemeinsames Interesse ein "Zwischen-den-egozentrischen-Polen-Sein" ist, berühren sie sich ganz. Das Interesse am anderen besteht im Aufenthalt zwischen ihm und sich selbst. Dort transformiert das Ich sich selbst in den Bezug der Dinge, die es erkennt; und stellt fest, dass es in seiner größten Freiheit namen- und eigenschaftslos ist. Es stellt fest, dass keine benennbare Polarität geeignet ist, es einzufassen.
Einsamkeit ist ein Strukturelement jeder egozentrischen Grundhaltung. Sie erscheint, wenn das Ich sich auf ein Selbst bezieht, dessen Schwerpunkt es eigenmächtig festlegen will. Einsam ist, wer daran glaubt, dass er alleiniger Herr in einem eigenen Haus sein kann, in dem alles Fremde ausgeblendet bleibt. Doch in der Begegnung erst ergänzt sich das Ich zu dem, womit es ohne Reue tatsächlich identisch sein kann. Der Kontakt ist die Integration zweier Ichs zu einem transpersonalen System, dessen überpersönliche Anteile konstitutive Teilaspekte der Personen sind und das durch seinen überpersönlichen Eigensinn dafür sorgt, dass das Geschehen im Spannungsfeld der Pole von keiner Seite her einseitig gesteuert wird.
Der Bewegungsimpuls des Berührens ist kein Anschubsen, durch das der eine den anderen in eine gewünschte Richtung lenkt, sondern ein Beirühren zuträglicher Momente. Deshalb ist der Kontakt dem, der berührt wird, förderlich, ohne sein Wesen zu bestimmen. Wer Mangels Verständnis für die eigene Natur glaubt, man habe, wenn man für den anderen doch nur "das Beste" wolle, auch schon das Recht, ihn dazu zu drängen, wird sein Ziel nur allzuoft verfehlen. Da es nämlich zum besten des anderen gehört, nicht von außen fremdbestimmt zu sein, sorgt das Wesen des Kontaktes von selbst dafür, das grobe Verstöße gegen seine Regeln zum Scheitern verurteilt sind.
Daher behindert sich jeder Impuls zu solidarischer Förderlichkeit von selbst, wenn es sich um eine Fürsorglichkeit handelt, die gegen das Gesetz der Ebenbürtigkeit verstößt. Es besteht kein Interesse daran, dass der eine den anderen als Wohltäter zu seiner Wohltat vereinnahmen kann. Mit dieser Art der Wohltäterei belegt bloß das Ich dessen, der es scheinbar so gut meint, dass es sich eigentlich für unentbehrlich hält und deshalb im wirklichen Kontakt nicht riskiert werden will. Oft sorgt sich ein Wohltäter nicht um das Opfer, dem er hilft, sondern darum, dass er vom Schicksal selbst geopfert werden könnte, sobald er niemandem mehr nützlich ist. Wer von oben herunter hilft, will Kontakt vermeiden und sich damit eine privilegierte Stellung sichern, die seine Angst vor dem Dasein mildert. So gibt es im reinen Kontakt weder einen gesunden Egoismus, noch einen gesunden Altruismus, weil derlei "Ismen" Vorurteile sind, die die unvoreingenommene Wahrnehmung des Geschehens im Kontakt vereiteln. Durch beide Begriffe wird ein gestörtes Kontaktverhalten als erstrebenswertes Ziel verkannt. Jede formulierte Weltanschauung und jede organisierte Religion ist daher ein Versuch, dem Kontakt mit der Wahrheit zu trotzen, indem man der Wahrheit Bedingungen stellt.
Die tatsächliche Solidarität als Strukturbegriff des interpersonellen Kontaktes meint kein Dienstverhältnis zwischen zwei in unterschiedlichem Ausmaß gelungenen Autonomien, in dem der Stärkere vorsorglich dient, um ein schlechtes Gewissen wegen seiner Privilegien zu vermeiden. Der Begriff meint vielmehr, dass die Kategorien der Stärke mit denen die Ichs ihren Status bemessen, zu belangloser Größe zusammenschrumpfen, sobald es dem Ich gelingt, aus seinem Winkel hinauszublicken und wenn es begreift, dass es sein Wesen nur erfüllen kann, wenn es sich mit allen anderen in denselben Topf wirft.
Kreist der Habicht über dem Hof, duckt sich das Federvieh und erstarrt im Gras. Oder es eilt im Laufschritt zum Stall und sucht Deckung. Unbewusste Inhalte der Psyche verhalten sich ähnlich, wenn über ihnen der schneidende Wind eines Bewusstseins weht, das mit dem Schnabel eines verhärteten Gewissens nach einer Beute sucht, die es zerreißen kann.
Der "Habicht" ist ein Vogel, der seiner Beute habhaft wird und sie im Griff seiner Krallen in einen tödlichen Himmel hebt. "Habicht", "haben" und "heben" sind Abkömmlinge der indoeuropäischen Wurzel "kap = fassen, packen". Wer sich nur weit genug über die hühnergroßen Unterschiede zwischen den Begriffen erhebt, kapiert sofort, dass das unterschiedliche Gegacker und die verschiedenen Farbmuster ihres Federkleides die wesentlichen Gemeinsamkeiten nicht überdecken kann.
Aus dem Wort "kap" machten Jahrtausende später die Römer, denen bei Verben bekanntlich nur selten etwas anderes einfiel, als den Infinitiv auf "-are", "-ire" oder "-ere" enden zu lassen, "capere = nehmen, fassen, begreifen". Zwei weitere Jahrtausende später bildeten namenlose Schüler, vom humanistischen Bildungsideal gleich der wehrlosen Beute eines Habichts bis aufs Blut gepeinigt, als weithin sichtbares Fanal ihres Leidens aus dem lateinischen "capere" das umgangssprachliche "kapieren = verstehen" und legten damit eine Spur, die es uns Heutigen leichter macht, den grundlegenden Sinn der Akzeptanz beim gesunden Ich-und-Du-Kontakt zu begreifen. So war das Leiden der Lateinschüler nicht ganz umsonst!
Auch die "Akzeptanz" gehört zum Sinngeflecht des Kernmotives "kap", das sich im Habicht als vogelfreie Variante in die Einsamkeit extremer Höhen inkarniert. "Akzeptieren" kommt vom lateinischen "acceptare" - der Kursivdruck hebt dabei jenen Teil des Wortes hervor, der seine Verwandtschaft offenbart. "Akzeptieren" heißt "annehmen" und wenn man sich den Begriff wie ein Hühnchen im Munde zergehen lässt, schmeckt man rasch seine assoziative Verbindung mit den Begriffen der "Solidarität", der "Integration", der "Ebenbürtigkeit" sowie der "Gegenseitigkeit" heraus, die längst schon als Strukturkriterien des gesunden Kontaktes definiert wurden. Man könnte daher annehmen, die Untersuchung der Akzeptanz böte der Neugier nichts Neues. Weit gefehlt! Akzeptanz ist ein so unerlässliches Motiv, dass ihre genauere Analyse vieles erst verstehen lässt, was sich auf der Ebene des Ichs, also dem Dreh- und Angelpunkt der Dynamik zwischen dem innerseelischen Prozess und der sozialen Kommunikation bei der Begegnung tut.
Greifen wir erneut das Bild des Habichts auf! Der Habicht gilt als vogelfreie Variante, weil er, anders als die Akzeptanz, einen extremen Pol des untersuchten Sinnes vertritt. Trotz seines blutigen Schnabels gebührt jedoch auch ihm ein Platz im Schoße der Familie, weil selbst der Habicht "annimmt", auch wenn es den Hühnern samt ihrer Dummheit lieber wäre, er würde sie verschmähen. Beim zwischenmenschlichen Kontakt steht dagegen eine Akzeptanz im Vordergrund, die im Zustand geringster Energie gelassen um einen Nullpunkt schwingt, in dem das Angenommene weder von links bestochen und vereinnahmt noch von rechts aufgefressen und in Besitz genommen wird.
Die "Solidarität" wurde oben schon eingehend diskutiert. Bei der Solidarität handelt es sich um ein bejahendes Fördern dessen, dem man im Kontakt begegnet. Ist die Solidarität für den gesunden Kontakt bereits ein wesentliches Prinzip, dann ist es die Akzeptanz noch prinzipieller. Denn der Bereitschaft zu fördern geht die Annahme dessen voraus, was, ohne sich an widerständigen Schwellen abmühen zu müssen, das empfängliche Bewusstsein jenes Du`s erreicht, von dem es dann Förderung erwarten kann. Doch die Akzeptanz des Ichs für seelische Motive und Impulse beschränkt sich nicht auf eine vorurteilsfreie Offenheit gegenüber einem Du, sondern - und das ist für den gesunden Kontakt bedeutsam - auch für das, was zur inneren Wahrheit des Ichs selbst gehört. Das von seinen Scheuklappen befreite Ich nimmt im gesunden Kontakt sich selbst und den anderen ohne einseitige Parteinahme an.
Es ist klar, dass dies nicht ohne Konflikte gelingen kann. Die echte Akzeptanz backt keinen Eierkuchen, bei dem sich die Zutaten aus Ich und Du zu einer süßen Pampe vermengen, mit der man alle Gegensätze überkleistert. Im akzeptierenden Kontakt begegnet man sich aber nicht mit Sollvorstellungen - wie man selbst oder der andere sein sollte - sondern man nimmt Stellung zu dem, was im konkreten Jetzt der Begegnung tatsächlich ist. In der absoluten Begegnung vergisst man, dass man je geurteilt hat.
Lieber als dass ich eine Akzeptanz vortäusche, hinter der nichts ist, anerkenne ich im Dienste wachsender Fähigkeit zur Akzeptanz den Widerstand in mir, der mich daran hindert, dies und das vom anderen anzunehmen. So steckt in einer Beziehung, die das bisher Unvereinbare nicht verleugnet mehr Toleranz, als im Zuckerguß einstudierter Nettigkeit. Die echte Akzeptanz schreckt nicht vor dem Eingeständnis zurück, dass in ihrem Himmel ein Habichtpärchen kreist, das Hühner lieber tötet, als seine Einsamkeit an geselliges Beisammensein zu verraten.
Eine besondere Beachtung verdient die Verbindung zwischen der Akzeptanz und dem begreifenden Verstand. Wissen ist die Akzeptanz des gewussten Musters in die gestaltete Gesamtstruktur des Geistes. Was der Geist weiß, hat er entweder wie ein Habicht von außen begriffen oder er hat es von innen verstanden, indem er sich in das, was es zu verstehen gibt, verstellt. Welchen Modus er auch wählen mag; um etwas zu verstehen, muss der Geist den Gegenstand der Erkenntnis zuerst akzeptieren. Umgekehrt ist die Bereitschaft, auch Unbekanntes rasch als zugehörig anzunehmen, dem Fortschritt des Verstandes förderlich. Wer sich und andere, nicht nur trotz, sondern wegen beidseitiger Merkwürdigkeit, bereitwillig annimmt, wird im Kontakt zu kommunikativen Handlungen fähig, die mehr bewirken, als alles Hantieren mit der Goldwaage. So bildet die Akzeptanz und der Verstand in einem zyklischen Kreislauf gegenseitiger Verstärkung wie Nabe und Reifen ein Rad und da beides Faktoren sind, die im Kontakt das Fortschreiten des kommunikativen Prozesses bewirken, rollt das Rad seinem unbekannten Ziel entgegen.
Wenn der Habicht kommt, ducken sich die Hühner. So bleibt manches leider unbewusst, wenn der Geist nur den Stolz des Habichts kennt, der aus sicherer Höhe zu begreifen versucht und wenn es ihm an der Demut fehlt, die Welt auch aus dem Herzen des Kükens zu sehen, das nur geopfert werden darf, wenn ein verstehender Geist mit ihm gemeinsam seinen Tod erleidet. Der authentische Geist, der im wirklichen Kontakt sichtbar wird, ist immer Habicht und Küken zugleich. Das Ich, das im Kontakt die Stelle des Geistes vertritt, unterliegt wegen dieses Gegensatzes stets der Gefahr, entweder zu sehr Habicht zu sein, so dass sich manches Motiv seiner Seele angstvoll im Unbewussten vergräbt oder bloß ein naives Küken, das zum eigenen Schaden seine Krallen verleugnet, weil es glaubt, man könne die fremde Gefahr durch Piepsen aus der Begegnung verbannen.
Will man sich selbst erkennen, muss man dafür sorgen, dass sich der Prozess der Erkenntnis frei um den Nullpunkt der kognitiven Akzeptanz bewegt. Erst dann gelingt es dem Ich, in seinem Selbstbild die widerstreitenden Pole seiner Existenz im Gleichgewicht zu halten und keinen seiner Aspekte zu verdrängen. Diese Balance ist für den Kontakt wichtig. Ohne sie findet man nicht den Abstand zu seinem Gegenüber, sondern man fällt aus der passenden Position entweder nach vorne oder nach hinten heraus. Dann ist man bei der Begegnung nicht richtig da oder schon durch den Brennpunkt hindurch. Der Kontakt zum anderen ist das ontische Regulativ, an dessen Kontrapunkt das Ich die Balance seiner Seele ausrichtet.
Steine bestehen auch, wenn sie von den Gesetzen der Kristallisation mineraler Moleküle und der atomaren Kohärenz nichts ahnen. Sollten sich die Gesetze einmal überraschend ändern, dann gehen die Steine vermutlich kaputt, ohne sich gegen ihr Schicksal zu wehren. Man kann vermuten, dass sich Steine, die sorglos im Bachbett liegen, für den Fall veränderter Bedingungen kein alternatives Daseinsmuster zurechtgelegt haben, um einer möglichen Bedrohung ihrer Kohärenz zu begegnen. Sobald der Schnee zu schmelzen beginnt, schwillt das Wasser im Bachbett an, entstehende Strudel zermahlen den Stein zu Sand und die Säuren im Wasser lösen zuletzt den Sand in seine Minerale auf. Was übrigbleibt ist saurer Sprudel. Noch kein Stein hat sich zur Vermeidung dieses doch so vorhersehbaren Schicksals mit einem Sprung an Land gerettet.
Auch die Winde wehen, ohne die atmosphärischen Druckunterschiede, die zu ihrem Erscheinen führen, vorher zu berechnen. Wenn Druckgradienten nicht mehr zur Verschiebung von Luftmassen führen, bleiben Winde, ohne vor Kummer noch eigens zu seufzen, einfach aus. Die reine Physik kennt keine Bedingungen, für deren Auftreten sie ihre Phänomene durch Voraussicht wappnet. Sie kennt auch keine Zukunft in unserem Sinne. Die Physik steht trotz aller Dynamik in ihrem Inneren als Ganzes still.
Anders als die unbelebte Materie verhält sich das Leben. Lebewesen sind jene Teile der Wirklichkeit, deren Dasein Ausdruck einer Kenntnis von gegenwärtigen und zukünftigen Umweltbedingungen ist. Die Matrix der Körper und das Muster der physiologischen Aktivitäten ist eine Vorausschau der Welt, der das Leben da draußen begegnen wird. Lebende Organismen sind in Struktur und Verhalten komplexe Abdrücke jener Wirklichkeit, an deren Formen sie angepasst sind. Die erfolgreiche Anpassung belegt, dass die Kenntnisse, die beim Aufbau ihrer Körper und bei der Aufrechterhaltung des Metabolismus zur Anwendung kommen, richtig sind und jenen Gesetzen entsprechen, die die Form dieser Wirklichkeit bestimmen. Der Wahrheitsgehalt der Informationen, die die phylogenetischen Entwicklungsreihen im Laufe der Stammesgeschichte aus der Wirklichkeit extrahiert haben, wurde am Scheideweg von 'Sein oder Nichtsein' bis zum Überdruss ausgetestet. Das bewährte Wissen, also jenes, dem Wahrheit zugrunde liegt, liegt im molekularen Gedächtnis des Zellkernes bereit. Indem sie sich belebt, reichert die Welt Wissen über sich an, das auf seinen Wahrheitsgehalt hin geprüft ist.
Ob dieser Ansammlung von Wissen ein Subjekt entspricht, dem das gesammelte Wissen bewusst ist, bleibt eine Frage der metaphysischen Spekulation. Letztlich unbeweisbar bleibt auch, ob die vielen kleinen Richtigkeiten, die das Leben über die Welt herauszufinden vermag, sich zu einer kohärenten Einheit namens "Wahrheit" zusammenfügen, die den Sinn, den sie womöglich sucht, in ihrem Inneren findet. Für die weitere Untersuchung gilt aber das Axiom, dass es die eine Wahrheit gibt und dass sie eine sinnvolle Gestalt ist, deren Einzelteile nicht nur zufällig beieinander liegen, sondern sich in überlogischer Folgerichtigkeit aufeinander beziehen und sich ihre Notwendigkeit durch den Bezug wechselseitig bestätigen. Der Halt im Nichts besteht im gestimmten Bezug zu allem. In jedem Teil schwingt dieses Alles um das Nichts. Die Welt ist die Resonanz von ungezählten Tönen und ein Klang, der sich beliebig oft aus dem Schweigen erhebt.
Insofern wahr ist, was die Wirklichkeit über sich selbst wissen könnte, ist das Wesen von Pflanzen, für die es vorgesehen ist, bei Frost die Blätter abzuwerfen, ein Teil dieser Wahrheit. Das Wesen der Pflanze ist ein unbewusstes Wissen darüber, was in ihrer ökologischen Nische als wahr angenommen werden kann - und wird. Was die "Wahrheit" der Nische verfehlt, hat darin keinen Bestand. Die Nische ist ein Werkzeug in der Hand des Ganzen, mit dem es das Wissen der Pflanze prüft. Als Pflanze weiß das Ganze, was in diese Nische passt. Die Pflanze verkörpert die Wahrheit ihrer Nische. Wahr ist, was sich erfolgreich auf Teile des Ganzen bezieht. Das Ganze formt Strukturen aus, um daran zu ermessen, was es ist.
Tiere sind nicht nur ins Biotop gesetzte Kenntnis von dessen Struktur, sondern sie setzen für die Umtriebe ihrer Lebendigkeit auch noch ein Wissen ein, das ihnen in Form jener aktuellen Daten zukommt, die das Zentralnervensystem auf dem Wege über die Sinnesorgane ständig aus der Umwelt erreichen. Die Struktur des Zentralnervensystemes selbst ist wie das ganze Tier eine Inkarnation von Kenntnissen, die sich durch ihre Richtigkeit mit Teilen der Wahrheit überschneiden und der ganzen Wahrheit durch ihre Teilidentität verpflichtet sind. Die Verpflichtung gilt, weil der Teil der Wahrheit, der sich in der Struktur des Gehirns verkörpert, nur wahr ist, sofern er im abgestimmten Resonanzbezug zu allem, was sonst noch wahr ist, steht. Wenn die Struktur des materiellen Systems auf wahren Hypothesen beruht, kann sich seine Funktion von diesem Erbe nicht grundsätzlich lösen. Auch die Psyche bleibt daher auf Wahrheit als Ursprung des Lebens bezogen. Sie kann Wahrheit niemals ganz verfehlen.
Das Zentralnervensystem der Tiere ist eine notwendige Bedingung, damit im Tier verschiedene Motive und Impulse je nach innerer und äußerer Lage der Dinge in das einheitliche Verhalten eines Körpers umgesetzt werden. Dem Prozess der Integration verschiedener Informationen sowie der Wahl des verwirklichten Verhaltens nach affektbegleiteter Simulation denkbarer Möglichkeiten entspricht das Phänomen der Psyche, die dem Tier entsprechend seines bescheidenen Entscheidungsbedarfs zwar eigen ist, die es aber in Ermangelung einer Instanz, der sie bewusst werden könnte, nicht als etwas wahrnimmt, worauf es selbst willkürlich Zugriff hätte.
So kann man sich denken, dass im Löwen unter der Akazie zu Beginn des Abends die Stimmung von Trägheit zu Hunger wechselt und dass sein Gehirn diesen Umstand mit dem Duft einer Antilope in Verbindung bringt, deren Körper sich im Gras der dämmerigen Savanne gegen den blutroten Himmel des Schicksals als Schatten abhebt. Und es mag sein, dass die Szene in Augen, Nase und Lefzen des Löwen als Bild seiner Wildnis erscheint, so wie auch wir sie sähen, wenn wir an der Stelle des Löwen lägen und in unserem Gehirn derselbe Ausschnitt der Wirklichkeit, der Hunger, das Blut und der Fluch des Tötens zu einem Abbild zusammenkäme. Vielleicht ist der Unterschied nur der, dass der Löwe mit Blick auf die Antilope spontan die Muskeln anspannt, während wir die Freiheit zur Entscheidung haben und uns fragen, warum wir zum Teufel eigentlich wie Löwen im Gras herumliegen. Für den distinguierten Räuber gibt es Antilope Natur auch im Restaurant der Hatari-Lodge, ohne dass man dem Tier erst noch artfremd die Kehle durchbeißen müsste. Und vielleicht trifft man in der Lodge die schöne Laura, die man bei ihrer Trauer um den Verlust des Löwenforschers trösten könnte.
Das besondere am Menschen ist nicht, dass er der einzige wäre, in dem ein Ausschnitt der Wirklichkeit als zusammenhängendes Bild verschiedener Sinneseindrücke und als sinnvolle Kohärenz mehrerer Teile einer Wirklichkeit erscheint. Auch im Tier erscheint ein Bild, das sich der Wahrheit jener Welt nähert, für deren Erkennen es vom Gehirn als Grundlage seiner Berechnungen herangezogen wird. Der Erfolg des Tieres beim Überleben gibt dieser These Recht. So fehlt dem Tier zwar ein Ich, das einem Du über das Bild im Tier berichten könnte und das dann sagt 'Mir ist die Welt bewusst', doch warum sollte man daran zweifeln, dass auch die Welt des Tieres hell ist, wenn die Sonne scheint?
Das Neue am Menschen ist auch nicht die Psyche, sondern dass in der Psyche ein Ich entsteht, das die Antilope nicht nur sieht und Hunger spürt, sondern sich dessen bewusst wird, weil es frei über die Präferenz seiner Impulse entscheiden soll. Bis zum Auftauchen dieser Teilfunktion des Menschen, die ihn vom Exemplar zur Person mutieren lässt, gab es im Verhalten der Tiere keinen Eigensinn, der sich dem jeweils dominanten Impuls, der vom phylogenetisch geprägten Nervensystem im Interesse der Spezies zur Ausführung vorgeschlagen wird, widersetzen konnte. Das Ich ist die Partei des eigenen Körpers in einem psychischen Parlament, das einst im Interesse der Stammesgeschichte ins Leben gerufen wurde.
Der Konflikt zwischen Impulsen zur Zugehörigkeit und jenen zur Autonomie ist ein psychologisches Phänomen, das zwar durch die Auflösung der Mutter-Kind-Diade zu erklären ist, der aber bis in die ontische Schicht der Conditio humana hineinreicht. Mensch zu sein heißt, dem Hauptstrom der Phylogenese widersprechen oder beipflichten zu können. Das Ich kann sich zwischen der Harmonie mit dem Umfeld und dem Dienst an einer eigenen Autonomie entscheiden.
Vermutlich ist es die tiefe Verankerung des Lebens in der ontischen Schicht der Wahrheit, deren Sammlung und Kenntnis das Leben ja erst möglich macht und die damit auch dem Ich zugrunde liegt, die dazu geführt hat, dass die menschliche Psyche als Ich die Möglichkeit fand, sich selbst zu widersprechen. Aus der Mathematik, dem logischsten Aspekt der Wahrheit, kennt man viele Gleichungen, die mehr als eine Lösung haben. Vielleicht stößt das Gehirn, das gewiss auch mathematischen Gesetzen gehorchen muss, bei seinen Simulationen sinnträchtiger Entscheidungen auf widersprüchliche Resultate, die wie manche Resultate der Algebra zwar gleich richtig sind, aber nicht gleichsinnig und schon gar nicht gleichgültig und wo nur durch die willkürliche Wahl etwas entschieden werden kann. Dann könnte es sein, dass erst die Freiheit der Wahl das Richtige ins Sinnvolle und wirklich Gültige überführt.
Da das Ich als Organ des Lebens eine Emanation der Wahrheit ist, ist es bei der Erfüllung seiner Parteilichkeit kein geschlossenes System. Die Willkür, zu der es fähig ist, ist nicht absolut. Sie bleibt ihrer Quelle verpflichtet. Zwar kann sich das Ich auch gegen das Wahrhafte stellen, da Wahrheit jedoch ursprünglichste Grundsubstanz des Ichs ist, schwächt der Mangel an Wahrhaftigkeit dessen Potenz. Wie Seneca schon richtig bemerkte, wird das Ich durch Versteifung auf falsche Urteile krank. Mehr noch als der eher psychologische Abhängigkeits-Autonomie-Konflikt, als dessen Richter das Über-Ich fungiert, fordert der ontische Konflikt zwischen Egozentrik und Treue zur Wahrheit das Ich zur existentiellen Entscheidung heraus. In die richtige Richtung zeigt hier nicht das Über-Ich, sondern das Gewissen.
Zwar wird das Ich - folgt man der nüchternsten Hypothese zu seiner Entstehung - als moderne Unterfunktion von der Psyche kreiert, um damit gegen den blinden Gehorsam zu rebellieren, doch bleibt der Spielraum der Rebellion begrenzt. Nicht dass das Ich einer Wahrheit gehorchen müsste, die ihm von oben mit erhobenem Zeigefinger quasi teleologisch zukommt, sondern durch ein Abweichen vom Wahren schwächt es sich selbst, da das Wahre sein Ursprung ist und es durchs Falschsein die eigene Struktur verrät. Wenn sich das Ich belügt, verstößt es gegen sich selbst.
Indem das Ich durch seine Fähigkeit zur Wahl sich zwischen dem bisher Gleichgültigen entscheiden kann, erschließt es dem Leben jene Bereiche der Wahrheit, die nur einem Geist zugänglich sind, der Paradoxien als Bereicherung der Logik erkennt.
Transzendenz als Thema des Kontaktes taucht nun darin auf, dass sich das Ich immer wieder auf zwei Ebenen zu entscheiden hat. Die "richtigen" Entscheidungen sind einerseits Grundlage und andererseits Folge gelingender Kontakte. Auf der psychologischen Ebene geht es um Abhängigkeit und Autonomie. Es geht um den Versuch, Eigenständigkeit und Zugehörigkeit zur Synthese zu bringen. Dieser Konflikt kann auf Dauer nur gelöst werden, wenn das Ich auf eine tiefere Konfliktebene hinüberwechselt. Solange man sich noch mit der Wahl abmüht, ob den Parteiinteressen des Ichs eher die persönliche Autonomie oder eher die Zugehörigkeit zum schützenden Kontext dienlich ist, bleibt das Ich in seiner Egozentrik gefangen. Der Abhängigkeits-Autonomie-Konflikt ist bloß ein Richtungskampf im egozentrischen Lager um die Wahl der besseren Taktik.
Die große Richtung im Leben findet man aber nicht, wenn man fragt, was nützt, sondern wenn man fragt, was richtig ist. Das Ich kann den psychologischen Konflikt zwischen den Wünschen nach Abhängigkeit und Autonomie über die Enge der Nützlichkeit hinaus transzendieren, indem es sich im ontischen Konflikt zwischen Egozentrik und Wahrheit entscheidet. Die Entscheidung zur Wahrheit ist die Transzendenz des Ichs hinaus über die Grenzen der eigenen Perspektive.
Da das Ich vermutlich ein Konstrukt der Psyche ist und damit seine homogene Einheit fraglich, wäre auch die Frage nach der Transzendenz im Sinne eines Überlebens nach dem Tod des Körpers nicht einheitlich zu beantworten. Insofern nicht so sehr das Ich einen Körper hat, sondern der Körper ein Ich und insofern das Ich die Interessen des individuellen Körpers parteilich gegen das soziale Umfeld vertritt, wäre es verwunderlich, wenn der Anwalt dieses Körpers überleben würde, obwohl sein einziger Mandant hungrigen Würmern zum Opfer fiele. Eine Individualität, die den Tod überlebt, würde die ewige Arbeitslosigkeit des Anwalts bedeuten und die Parkbänke im Himmel würden unter der Last zerstrittener Juristen stöhnen, die in Ermangelung lebendiger Auftraggeber bei der Diskussion erfundener Interessenskonflikte vom Hundertsten ins Tausendste kämen. Wenn vom Ich also etwas übrigbleibt, kann es an seiner Individualität kein großes Interesse haben. Denkbar wäre, dass von ihm nach dem Tod nur bleibt, was sich zu Lebzeiten mit Wahrheit deckt, was zu Lebzeiten Anwalt dessen war, was den Tod des eigenen Körpers überdauert. Und wenn es etwas von seinem Überleben merkt,dann, weil Wahrheit sich als Bewusstsein der Wirklichkeit erweist.
Bis zur Lösung des Rätsels im Jenseits bleibt im Diesseits beim Überschreiten beengter Horizonte genügend zu tun, sodass man den Blick nicht lange aufs Unerkennbare zu richten braucht. Der zwischenmenschliche Kontakt ist Herausforderung genug, eigenen Grenzen zu überschreiten. Es ist also kein Wunder, dass das Thema der "Überschreitung" bei der etymologischen Analyse der Begriffe "Kontakt", "Berührung" und "Verbindung" immer wiederkehrt.
Das "Miteinander-in-Kontakt-kommen" ist eine gute Methode (metahodos = Übergang) um im eigenen Bezug zur Existenz von einer isolierten Position narzisstischer Selbsttäuschung zur verwirklichten Einbindung in den realen Kontext zu transzendieren. Transzendenz ist kein "bloß-weg-von-hier-nach-irgendwo", keine Himmelfahrt nach absolvierter Erdenstrafe, sondern der oft steinige Weg in die bewusste Begegnung mit der Realität. Die Realität liegt jenseits der Transzendenz,aber man geht nicht dorthin. Man kommt hierher. Ermutigt vom Erlebnis des realen Kontaktes sucht man den Ausweg aus der Enge der Vereinzelung nicht mehr in den Luftschlössern metaphysischer Paradiesgedanken oder der heimlichen Größenphantasie, sondern man transzendiert in ein Dasein der Kontakte, in deren schlichter Wahrheit man selbst wirklich wird. Erst wenn man im Kontakt die Gelegenheit hat, zu sagen, was man tatsächlich denkt und fühlt, kann man merken, was man wirklich ist. Merkt man, was man wirklich ist, verliert man an der Angst ums eigene Ego den Großteil des Interesses. Die Existenzangst, die jeden mehr oder weniger ins neurotische Verhalten treibt, entpuppt sich meist, wenn man im lebendigen Kontakt mit sich identisch ist, als überschaubares Problem am Rande, als zu verzerrter Größe projizierter Schatten einer Kindheit, in der man arglos einem schützenden Schoß entsprungen ist und wehrlos wie ein Kind auf viel zu viel Angst und Feindseligkeit traf.
Kontakte bringen jeden, der sich darin bemüht, sich nicht selbst zu betrügen, in seiner Entwicklung voran. Wenn man sich nicht aktiv gegen die Wirkung der Kontakte sträubt oder sich nur für die vordergründige Sicherheit interessiert, die die Verbindung bietet, dann sind Kontakte immer propulsiv. Am meisten nützen sie, wenn man in bester Weise fromm und stets dazu bereit ist, ohne Taktik und Berechnung, klar zu sagen, was man denkt. Am besten gelingt der Kontakt, wenn man nur das Vergnügen darin sucht, sich ziellos der unerreichbaren Ferne zu opfern.