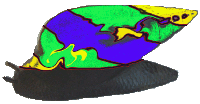
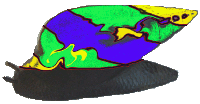
Könnten wir sicher sein, dass es Gott gibt, wäre Vertrauen kein Wagnis. Müssten wir nichts mehr wagen, gäbe es uns nicht. Gott ist so frei, dass wir seine Existenz nicht beweisen können. Könnte man seine Existenz beweisen, wäre er nicht Gott, denn der Beweis würde ihn der Beweisbarkeit unterwerfen. Das wird er nicht mit sich machen lassen.
Wohlgemerkt
Theologische Aussagen sollte man nicht als eindeutig akzeptieren. Aussagen über Gott sind allenfalls poetisch (von griechisch poiesis [ποιησις] = das Erschaffen). Aussagen wie...
... sind nachträglich erschaffen. Sie sind nicht eins zu eins aus der Wahrheit übertragen. Da sie nicht eins zu eins aus der Wahrheit übertragen sind, können sie auch nicht eins zu eins auf die Wahrheit angewendet werden. Sie sind Werkzeuge zwischenmenschlicher Verständigung.
"Gott" ist Hypothese und Metapher. Der Begriff unterstellt, dass das Gute nicht nur Urteil in Köpfen, sondern Grundsatz der Wirklichkeit ist.
Zwei Bestandteile stecken im Begriff Vertrauen: die Vorsilbe ver- und das Verb trauen, das seinerseits auf das Eigenschaftswort treu zurückgeht.
Die Vorsilbe ver- zeigt einen Wechsel an, ein Verschieben des Standpunkts von da nach dort.
Der gemeingermanische Sinn des Verbs trauen war fest werden. Zum gleichen gedanklichen Bild gehören...
Sie alle gehen auf das indoeuropäische deru = Eiche, Baum zurück, wobei die Eiche als Sinnbild besonderer Festigkeit galt, was der Urgermane beim Versuch, eine Eiche mit steinzeitlichen Äxten zu fällen, unschwer feststellen konnte. Im englischen tree = Baum ist das indoeuropäische deru erkennbar.
Vertrauen heißt, dem Wahren treu zu sein. Es heißt, sich auf die Unverbrüchlichkeit des Wahren zu verlassen, um geführt von ihm von da nach dort zu gehen. Das Dort des absoluten Vertrauens ist das Wahre selbst. Dieser Satz ist genauso wahr, wenn man Groß- und Kleinschreibung vertauscht: Das Dort des absoluten Vertrauens ist das wahre Selbst.
Die existenzielle Bedeutung des Vertrauens ist kaum zu überschätzen. Ohne Vertrauen gäbe es keine Menschheit. Die Natur hat es so gefügt, dass Neugeborene nur überleben, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:
Da das Kind keine Alternative zum Vertrauen in seine Bezugspersonen hat, vertraut es auf Gedeih und Verderb. Es geht blind davon aus, dass seine Eltern vertrauenswürdig sind; das heißt, dass es sich auf ihre Absicht, sein Wohlbefinden sicherzustellen, verlassen kann.
Gewiss: Jede hunderttausendste Mutter nimmt ihr Kind nicht in den Arm, um es hätscheln und zu säugen, sondern um es umzubringen. Trotzdem hat die Natur das Basisprogramm des frühkindlichen Verhaltens so ausgerichtet, als gäbe es diese Möglichkeit nicht. Zum Glück: Denn wie sollte sich ein Kind gesund entwickeln, wenn es sich bei jeder Geste seiner Eltern fragen würde, ob sie nicht dem Totschlag dient.
Es gibt kaum ein Kind, dessen Urvertrauen im Laufe der Entwicklung nicht aus der anfänglich naiven Totalität vertrieben wird. Eltern erweisen sich über kurz oder lang als nicht hundert Prozent vertrauenswürdig; zumindest was die Hoffnung des Kindes auf eine nie endende, vollumfängliche Erfüllung sämtlicher Bedürfnisse betrifft. Eltern werden müde, haben schlechte Laune, stinken nach Knoblauch und Zwiebeln, schaffen es nicht, sämtliche Signale des Kindes richtig zu deuten.
Statt die Decke zu lüpfen, weil es schwitzt, drehen sie die Heizung hoch, weil sie glauben, es friert. Statt es an sich zu nehmen, weil es Angst hat, drängen sie ihm Möhrenpampe auf und behaupten, das Kind esse einen Löffel für Mama, für Papa, für Oma und einen für Tante Gertrud. Was für ein Unfug!
Übertragung
In einer intakten sozialen Gemeinschaft wird das Urvertrauen des Säuglings, das zunächst seinen Eltern gilt - oft nach einer Phase des Fremdelns - auf die Gruppe übertragen. Bereits Rivalitäten zwischen Geschwistern können die Übertragung beeinträchtigen; erst recht Erfahrungen mit fremden Personen. Je früher und umfassender das Urvertrauen durch traumatische Erlebnisse erschüttert wird, desto schwerer wird es dem Individuum in der Folge fallen, sich unvoreingenommen auf neue Beziehungen einzulassen.Nicht genug, dass kindliche Erfahrungen mit Durchschnittseltern bereits durchwachsen sind, eine große Minderheit trifft es noch schlimmer: Ihre Eltern sind so in Probleme verstrickt, dass sie zu Gewalt, Vernachlässigung und chronisch irrationalem Kommunikationsverhalten neigen. Je nachdem, wie schlimm es kommt, kann das zu einer weitreichenden Beschädigung des ursprünglichen Vertrauens führen.
Die Rolle des Vertrauens endet nicht mit der Kindheit. Das liegt an der Ungewissheit des Daseins an sich. Die Abhängigkeit des Erwachsenen vom Wohlmeinen anderer mag deutlich geringer als die des Kindes sein, trotzdem lebt auch der Erwachsene in einer Welt, deren Entwicklung nur ansatzweise im Voraus zu berechnen ist. Unternimmt er Schritte, kann er nur selten sicher sein, dass sie zur Erfüllung seiner Wünsche führen; zumindest wenn es sich um komplexe Ziele handelt. Die Lücke, die zwischen Wahrscheinlichkeit und Gewissheit klafft, kann er nur durch Vertrauen füllen, und das heißt zugleich: durch Wagnis.
Das bisher Gesagte beschreibt nur eine Ebene des Vertrauens. Insgesamt gibt es drei:
Das menschliche Leben findet nicht nur in einer Natur statt, von der es abhängt, ohne dass es seine Abhängigkeit von den Launen der Natur durch ein umfassendes Wissen, wie man ihrer entziehen könnte, abschütteln kann.
Das menschliche Leben findet vor allem in sozialer Gemeinschaft statt. Dort hat man es zusätzlich mit dem sprunghaften Gutdünken eigennütziger Leute zu tun. Plant man, sein Leben nicht in einer Höhle am Dhauliganga zu fristen, muss man sich der Tatsache stellen, dass man mit Menschen nur zusammenleben kann, wenn man ihnen so weit vertraut, dass man es wagt. Gottlob sind die meisten meist so, dass das ein vertretbares Risiko ist.
Kaum ein Mensch behält das ursprünglich blinde Urvertrauen ungeschmälert bei. Dafür sorgt die Struktur der Wirklichkeit, die jedem Erfahrungen zumutet, die die Blindheit in Frage stellen. Das mag bedauerlich erscheinen, andererseits ist es aber auch gut. Denn wie sollte der Mensch dazu ermuntert werden, die Augen zu öffnen und selbst zu sehen, wenn er mit Blindheit durchkäme? Ginge das, wäre der Mensch kein Mensch, sondern ein Nacktmull.
Obwohl das Urvertrauen also geschmälert wird, bleibt in der Regel genügend übrig, um mit dem sozialen Umfeld in mehr oder weniger lebhaftem Austausch zu stehen.
Angebote von außen
Wenn Sie am Telefon als Glückspilz bezeichnet werden, der bei einer Tombola gewonnen hat, an der Sie gar nicht teilnahmen, könnte Misstrauen angezeigt sein.
Die schmerzhafte Enttäuschung des blinden Vertrauens mit nachfolgendem Erwerb gesteigerter Sehkraft hat nicht nur soziale Funktionen. Gewiss: Sehkraft hilft, Angebote von außen besser auf den Grad ihrer Vertrauenswürdigkeit hin zu überprüfen. Die durch enttäuschtes Fremdvertrauen stimulierte Sehkraft bahnt darüber hinaus eine neue Entwicklung, die im Rahmen der Individuation unverzichtbar ist: Eine Schulung in Sachen Selbstvertrauen.
Vermutlich weiß der Säugling nichts von sich selbst. Hunger entsteht, Milch fließt, Hunger verschwindet. Wen mag das wohl betreffen? Fließt die Milch nicht, ändert sich etwas. Hunger entsteht, Hunger bleibt, Hunger wächst, Hunger tut weh. Jetzt bekommt es Bedeutung, wen das betrifft. Nichts stachelt das Bewusstsein des Individuums zu mehr Aktivität an, als die Tatsache, dass es es ist, dem etwas wehtut.
Die physiologische Ernüchterung des Urvertrauens ist ein wesentlicher Faktor, der die Entstehung des Ich-Bewusstseins auslöst und vorantreibt. Frustration macht das Individuum auf sich selbst aufmerksam und fördert, sofern sie nicht mit entmutigender Wucht eintrifft, das Bemühen um mehr Selbständigkeit... und Selbständigkeit ist ein Resultat angewandten Selbstvertrauens.
Aus dem Vertrauen in Wohlmeinen, Kraft und Verlässlichkeit anderer wird ein Vertrauen in eigene Kompetenzen, in die eigene Urteilskraft und Verantwortungsbereitschaft für den Fall, dass eine Entscheidung andere Folgen nach sich zieht als die erwünschten.
Beim Selbstvertrauen macht es Sinn, eine oberflächliche und eine tiefe Ebenen zu unterscheiden.
Das oberflächliche Selbstvertrauen vertraut auf erworbenes Wissen und Können: Seit ich weiß, wie man Pfannkuchen bäckt, brauche ich nicht mehr darauf zu vertrauen, dass es jemand anderes für mich macht. Das oberflächliche Selbstvertrauen vertraut auf die Kompetenzen des relativen Selbst.
Der Begriff oberflächlich ist dabei nicht abwertend gemeint, etwa analog zur Formulierung Das ist eine oberflächliche Person. Der Begriff ist beschreibend. Er orientiert sich an einem Persönlichkeitsmodell, das analytische Denkvorgänge näher am dualistischen Pol der Wirklichkeit sieht und das präverbale Sein näher am Pol ungeteilter Einheit.
Gottvertrauen: Wenn ich mir im Wankelmut untreu werde, wird Gott mir meine Schuld verzeihen. Auch wenn das Leben hart ist und ich nicht verstehe, warum etwas geschieht, gehe ich davon aus, dass alles auf etwas wahrhaft Gutes hinausläuft.
Auch wenn wir das Selbst des Menschen als wesensgleich mit dem des Absoluten auffassen, führte es die Irre, würde man Gott, also das Selbst des Absoluten nicht als etwas ansehen, das kategorisch über das Selbst des Individuums hinausreicht. Obwohl das tiefste Selbstvertrauen daher nahtlos in Gottvertrauen übergeht, legt es das Gebot der Nüchternheit uns nahe, Selbstvertrauen und Gottvertrauen begrifflich zu unterscheiden. Denn: Wesensgleich ist auch der Tropfen mit dem Ozean. Trotzdem trägt er keine Schiffe.
Selbstvertrauen beruht auf der Annahme, dass das Individuum befugt ist, als Teil des Ganzen zu sich selbst zu stehen. Gottvertrauen umfasst die Idee, dass das Selbst des Individuums so unverlierbar ins Ganzen eingebettet ist, dass es folgerichtig ist, das Ganze als es selbst zu sehen.
Entsprechend der existenziellen Bedeutung des Vertrauens spielen pathologische Fehlentwicklungen eine große Rolle. Sie betreffen alle drei Ebenen und führen je nach betroffener Ebene und Ausprägungsgrad zu schwerwiegenden Störungen der seelischen Gesundheit.
Der quasi unvermeidliche Verlust an Urvertrauen, der parallel mit dem Erwachen des Ich-Bewusstseins in der frühen Kindheit einsetzt, kann in verschiedene Endstrecken einmünden:
Kommen die Verluste häppchenweise und sind sie erträglich, wird die Einbuße an Fremdvertrauen durch Selbstvertrauen kompensiert. Der Gesunde weiß, dass blindes Vertrauen naiv ist. Der in der Regel überschaubaren Gefahr, die von anderen droht, geht er gelassen entgegen, weil er sich bei schwerer Enttäuschung auf sich selbst verlässt.
Übersteigen die Verluste die Angsttoleranz des Kindes, traumatisieren sie. Aus Urvertrauen wird ein grundsätzliches Misstrauen, das die Beziehungsfähigkeit gegenüber der Wirklichkeit im Allgemeinen und anderen Menschen im Besonderen schmälert.
Kaskade traumatisierender Fehlentwicklungen
grober Vertrauensverlust
↓
überschießende Angst
↓
Extraversion der Aufmerksamkeit, um Quelle der Gefahr im Auge zu behalten
↓
eingeschränkte Bereitschaft zur Selbstwahrnehmung
↓
mangelnde Entwicklung des Selbstbewusstseins
↓
hinkende Entwicklung des Selbstvertrauens
Während die Vertrauensverluste bei der Mehrheit so moderat ausfallen, dass sie erfolgreich auszugleichen sind und in der Summe auf einem ebenfalls moderaten Niveau verbleiben, läuft die Entwicklung bei einer großen Minderheit anders. Es gelingt ihnen nicht, so viel Selbstvertrauen zu entwickeln, dass der Mut, sich unbefangen auf andere Menschen einzulassen, erhalten bleibt. Das Misstrauen gegen die Welt ist so groß, dass sich die Betroffenen nur eingeschränkt oder maskiert in Beziehung setzen. Um sich vor neuen Enttäuschungen zu schützen, versuchen sie in jeder Beziehung den anderen unter ihre Kontrolle zu bringen. Resultat sind Persönlichkeitsstörungen, die vom ängstlich-vermeidenden bis zum paranoiden oder gar dissozialen Pol reichen können.
Während mangelndes Vertrauen in Wohlmeinen und Verlässlichkeit anderer zu Störungen der Beziehungsbereitschaft nach außen führt, betrifft mangelndes Selbstvertrauen den Bezug zum eigenen Wesen. Nicht nur der Glaube an das Gute im anderen leidet, sondern vor allem der an den Wert des eigenen Selbst. Mangelndes Selbstvertrauen ist Ausdruck eines Minderwertigkeitsgefühls.
Wer an mangelndem Selbstvertrauen leidet, schirmt sich in der Folge nicht nur nach außen hin ab, um gefürchtete Bosheiten anderer abzuwehren und damit oft das Kind mit dem Bade auszuschütten, vielmehr ist das wenige an Achtsamkeit, das er überhaupt nach innen wendet, durch ein Misstrauen gegen die Legitimität eigener Impulse durchsetzt. Wer kein Vertrauen ins Innere hat, interessiert sich nicht dafür, weiteres davon zu entdecken. Im Gegenteil: Vieles will er nicht wahrhaben und vom Rest glaubt er, dass er besser anders wäre. Selbstmissachtung kann in Selbstverachtung übergehen oder gar in Selbsthass.
Gesetzt, jemandes Fremdvertrauen reicht aus, ohne ständigen Schutzschirm mit anderen zu kommunizieren. Gesetzt, derselbe Mensch hat ein stabiles Selbstvertrauen und betrachtet sich ohne falsche Bescheidenheit als gelungenes Exemplar der Spezies Mensch. Gesetzt, er geht außerdem davon aus, dass jenseits seines Todes nichts mehr kommt und seinem Leben folglich kein weiterer Sinn zuzuschreiben ist. Kann er dann ein gutes Leben führen? Natürlich kann er das. Er kann das Leben eines Menschen führen, der sich im Horizont des normalen Alltags erfolgreich einrichtet, ohne dass ihn ständig Weltschmerz plagt.
Oft ist es aber so, dass das Leben auch solcherart Menschen Härten zumutet, die den aufs Diesseits begrenzten Rahmen ihrer Zuversicht überfordern. Außerdem gelingt dem reinen Materialisten das Frohsein nur solange er störende Fakten durch Verdrängung aus seinem Bewusstsein beseitigt: vor allem drohendes Siechtum, Sterblichkeit und die Nichtigkeit einer Existenz, die nur vorübergehend in Erscheinung tritt.
Sonne und Erde
Alles Licht, das unser Dasein erhellt, ist eine Gabe der Sonne. Wir sind aber unfähig, der Sonne etwas zurückzugeben. Ihr Licht ist Geschenk. Zu glauben, man könne Gott etwas geben heißt, ihn für kleiner als einen Stern zu halten.Andere haben es da besser. Sie gehen davon aus, dass das Selbst, in dessen Gutsein sie beherzt vertrauen, Ausdruck einer Wirklichkeit ist, deren Festigkeit allen Prüfungen widersteht. Sie vertrauen darauf, dass alles, was Sie noch erleiden könnten, Etappe auf dem Weg zu Höherem ist. Wer so weit vertraut, braucht weder die Verirrungen anderer noch die seiner selbst so sehr zu fürchten, als dass ihm kleinliche Vorsicht den Genuss des Daseins vergällt.
Da solch heilsames Gottvertrauen zwar breit gesät ist, aber nur selten zu voller Blüte kommt, obwohl in jedem Menschen ein Saatkorn bereitliegt, lohnt es, Gründe dafür aufzuzeigen, weshalb die Saat nicht aufgeht. Zwei Gründe scheinen ausschlaggebend:
Die biologisch gebahnte Egozentrizität des Menschen wird durch die existenzielle Position seines Leibes im Universum bedingt. Da wir die Bühne des Lebens als zerbrechliche Kreaturen bevölkern, machen wir ein großes Bohei um den Vorteil genau der Person, die wir gerade mal sind. Das ist ihrer wirklichen Bedeutung nicht angemessen. Wir machen aus unserer Person einen Götzen, dem wir leichtfertig opfern, was uns zur Bespaßung des Götzen geeignet erscheint. Aus Urwäldern machen wir Nuss-Nougat-Creme.
Das größte Unglück der Religion war die Erkenntnis der Politik, wie gut man sie für deren Zwecke vereinnahmen kann. Wie vor Ihnen die Pharaonen haben Moses, Paulus und Mohammed politische Eier in religiöse Nester gelegt; gründlicher, geschickter, radikaler als ihre Vorgänger es taten. Alle Teichrohrsänger werden vermutlich niemals verstehen, was ihnen geschah.
Politik ist eine Expansion des Egoismus auf die Gruppe, als deren Mitglied man sich sieht und die für einen gemeinsamen Vorteil mit anderen Gruppen rivalisiert. Sobald sich die Politik der Religion bemächtigt, impft sie ihr genau das Gift ein, von dem die Religion den Menschen eigentlich befreien will: Eigennutz und die Begrenzung des Selbstbilds auf Partikelgröße.
Dass es im Abendland viel Gottesfurcht, aber kaum Gottvertrauen gibt, ist auch Resultat dieser Weichenstellung. Zu fürchten ist nicht das Absolute. Zu fürchten sind die, die die Verbindungswege zum Absoluten kontrollieren wollen, um das Herzblut des Geistes in ihre Kanäle zu schleusen.
Sura 40, 10**
Wahrlich, denen, die ungläubig sind, wird zugerufen: Der Haß Gottes ist größer als euer Haß gegeneinander.
Hass ist ein Affekt, den der empfinden mag, der sich bedroht fühlt oder dem ein nicht wiedergutzumachender Schaden zugefügt wurde. Gewiss hat sich Mohammed durch seine Widersacher bedroht gefühlt und ist der Hässlichkeit des Hassgefühls anheimgefallen. Da es neben Gott aber keinen Zweiten gibt, kann Gott sich als Gott nicht bedroht fühlen. Und wer wollte Gott einen Schaden zufügen, den Gott nicht prompt wiedergutmachen könnte?
Man kann sich ducken, damit man vom Hass einer Macht nicht getroffen wird. Sich einem Gott anvertrauen, der hasst, kann man aber nicht. Man braucht es auch nicht. Bevor sich das Heilige durch Hass beschmutzt, sorgt es dafür, dass kein Grund dafür besteht.
Auch das Christentum verkündet den hassenden Gott. Wer sonst sollte bockigen Schafen ewige Qualen in der Hölle bescheren? Das Christentum hat ein geistiges Klima geschaffen, dass Gottesfurcht zwar fördert, Gottvertrauen aber untergräbt. Indem es uns sein abrahamitisches Gottesbild vor Augen führt, fördert es Misstrauen und Angst.
* Die Heilige Schrift / Familienbibel / Altes und Neues Testament, Verlag des Borromäusvereins Bonn von 1966.
** Der Koran, (Komet-Verlag, ISBN 3-933366-64-X), Übersetzung von Lazarus Goldschmidt aus dem Jahr 1916.