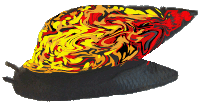
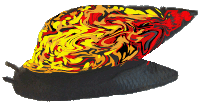
Der Kontakt
Der Klient leidet unter Kontaktstörungen. Seine Verhaltensmuster und Beziehungsformen verfehlen die Kriterien des "reinen" Kontaktes. Wäre er dazu nämlich in der Lage, hätte er keine Symptome, die er als unangemessen empfände. Was er seelisch erlitte, nähme er als den Preis eines authentischen Menschseins weise in Kauf und wahrscheinlich riefe er niemals beim Therapeuten an. Zum Glück für dessen Geschäfte ist das Kontaktverhalten des Klienten jedoch gestört oder in sozial scheinbar angepasster Weise verbogen. Statt individuell ist er vereinzelt. Statt solidarisch zu sein, hängt er von anderen ab. Deshalb leidet er und beim Therapeuten klingelt das Telephon. Vorrangiges Ziel der Therapie, die im Anschluss ans Klingeln zustandekommt, ist die Untersuchung und Heilung des pathogenen Kontaktverhaltens. Die neurotischen Symptome, die das Leiden des Klienten symbolisieren und den Anlass zur Therapie geben, werden als Teilaspekte gestörter Beziehungen - und zwar auch einer gestörten Beziehung des Ichs zu sich selbst - verstanden. Die Symptome sind die Brücken, über die der Klient den Kontakt zum Therapeuten aufnimmt.
Zwar bleibt die Beseitigung der Symptome Ziellinie der Therapie, sicherster Weg dorthin ist jedoch nicht die einseitige Verengung des Blicks auf die umgehende Beseitigung dessen, was vordergründig stört, sondern die Arbeit an einem Bewusstsein, das klar erkennt, wie innerhalb der Beziehungen das passiv erlebte Leiden mit unerkannten Eigenaktivitäten zusammenhängt. Ein derart gesteigertes Selbst-Bewusstsein führt über eine Verbesserung der inneren und äußeren Kontaktfähigkeit zur Überwindung der Symptome. Die Psychotherapie setzt also am Kontakt an, weil sie dadurch die Symptome an der Wurzel packt. Ausgehend von dieser Perspektive lässt sich das seelische Leiden des neurotischen Menschen schlüssig verstehen und - oftmals - erstaunlich rasch heilen.
Der Psychotherapeut braucht den Ich-und-Du-Kontakt als die entscheidende Arena seiner Wirksamkeit, denn seine Arbeit findet mehr als alle anderen innerhalb der Begegnung statt. Zwar begegnen sich auch in anderen professionellen Beziehungen Ichs, doch dort bleibt im Vergleich zu dem, was bei der Psychotherapie passiert, die subjektive Ich-und-Du-Haftigkeit derer, die sich begegnen, hinter sachbezogenen Interaktionsebenen zurück. Beim Bäcker spricht man über Brötchen und Wechselgeld, beim Rechtsanwalt über Paragraphen und Gerichtstermine, beim Arzt über Durchfall und Schleimauswurf und beim Pfarrer über Gott, den Teufel und fromme Rituale. Nur in der Psychotherapie ist alles Ferne nebensächlich. Hier spricht das Ich über sich und darüber, wie es im Kontakt mit seinen Du´s so schmerzhaft scheitert.
Gewiss, auch beim Anwalt und beim Arzt geht es um Umstände, die das Ich plagen. Beim Anwalt ist es Nachbar Schnesemann, dessen blödsinniges Nadelgestrüpp über den Jägerzaun wuchert und das der eigenen Tomatenpflanzung das süße Licht zum Reifen raubt. Beim Arzt stellen sich Salmonellen als eigentliche Übeltäter heraus. Wie man jedoch unschwer sieht, ist der Kontakt zwischen Anwalt und Mandant, zwischen Arzt und Patient bloß Mittel, von dem aus man auf ein Problem jenseits des Kontaktes blickt und vom Kontakt selbst ist nicht mehr von Belang, als dass es dabei korrekt und höflich zur Sache geht.
Im Gegensatz dazu taucht bei der Psychotherapie das Problem, das durch die Begegnung gelöst werden soll, innerhalb des Kontaktes, in dem die Lösung versucht wird, auf. Zum einen, weil ein Teil der grundsätzlichen Störung auf die Beziehung zum Therapeuten übertragen wird. Zum anderen, weil es um den Kontakt als solchen geht. Daher ist das Problem auch keine Sache, auf die man gemeinsam nach draußen blickt, sondern das Ich und das Du derer, die sich geschäftlich begegnen, sind als die beiden Pole, zwischen denen das Arbeitsfeld entsteht und das eigentliche Problem sichtbar wird, unmittelbar miteinbezogen - mehr noch: sie rücken ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Bei der Psychotherapie geht der Blick der Kontaktpartner daher hauptsächlich nach innen, selbst wenn ein Großteil des "bearbeiteten Materials" - also vergangene Kontaktepisoden und aktuelle Beziehungsmuster - von außerhalb stammt.
Parallelen zur therapeutischen Beziehung mögen beim Kontakt zwischen Pfarrer und Gläubigem zu finden sein. Sie sind jedoch begrenzt. Zwar geht es auch beim Pfarrer darum, was die Seele quält und ihr den unschuldigen Genuss mitmenschlicher Beziehungen verdirbt. Doch hier wird das Übel nicht durch Exploration individueller Motive und Kommunikationsstrukturen - also durch Neugier und Erkenntnis - sondern durch Verurteilung, Ermahnung und Rituale bekämpft.
Zwar betont auch der Pfarrer das dialogische Prinzip, doch nicht ohne es im gleichen Atemzuge wieder auszuhöhlen. "Wo zwei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen". Der Kommunikation wird so zwar das Zepter gereicht, den Personen, die sich konkret begegnen jedoch nur eine Stellvertreterrolle zugestanden. So wird das wesentliche Ziel der Achtsamkeit nicht im Hier-und-Jetzt belassen. Die Kommunikation blickt nicht auf die konkreten Personen selbst, sondern verweist in einen fernen Himmel. Darin liegt zwar eine Geste der Bescheidenheit, zu oft dient diese Art Bescheidenheit jedoch dazu, den tatsächlichen Mangel an Bescheidenheit hinter Idealen zu verstecken.
Dementsprechend stellt sich der Pfarrer dem Gläubigen nicht als ebenbürtiges Du in einer ursprünglichen Kommunikation. Er versteht sich vielmehr als Instanz, die sich in dem, was sie meint, nicht mehr in Frage stellt. Dass die geistliche Instanz vor der Begegnung bereits weiß, was richtig ist, ist sein grundsätzliches Prinzip, den Zweifel daran deklariert er gar als Sünde. So bleibt die reale Person des Pfarrers bewusst hinter dem Credo zurück und im Glauben, dass die geistliche Instanz das einzig Richtige bereits kennt, schwärmt er aus, um die anderen durch die "Begegnung" von seinem Vorurteil zu überzeugen.
"Pfarrer" ist sprachverwandt mit "Pferch", also einem eingehegten Platz. Der Pfarrer schirmt die Gläubigen ab - wie der Hirte das Schaf. Er versteht sich als Vormund. Da er sich "väterlich" über den anderen stellt, hält er wenig vom wechselseitigen Austausch der Ideen. Daher erwartet ein Pfarrer vom konkreten Kontakt auch nicht, darin etwas Neues zu erfahren. Wenn aber nichts Neues erfahren werden kann, dann ist die Begegnung nicht authentisch. Im Grunde findet eine echte Begegnung gar nicht statt.
Für den Pfarrer ist der andere also niemand, dem er wirklich selbst begegnet, sondern Zielscheibe einer gutgemeinten Wirksamkeit. Ihm geht es um die gefällige Unterordnung des Gegenübers unter die Regeln einer Konfession, weil er einfältig glaubt, dass ihm das Überzeugen und dem anderen die Zustimmung im Jenseits Pluspunkte bringt. Der Gläubige soll keine eigene Haltung formulieren und sich bewusst sein, wie er dazu steht. Er soll sich einer einheitlichen Moral anvertrauen - selbst dann, wenn er sie nicht nachvollziehen kann.
Im Gegensatz dazu verlangt der Therapeut keine Unterordnung unter eine "transzendente Macht", sondern er verweist auf eine immanente Macht, die scheinbar dann am besten Gutes tut, wenn der Einzelne sich im Dialog zu sich selbst bekennt. Das seelische Leiden verschwindet, wenn der Klient im Kontakt mit sich selbst stimmig wird, wenn sein Verhalten zu der Haltung passt, die ihm tatsächlich eigen ist. Das wichtigste Mittel, um auf die Macht im Inneren der geistigen Prozesse zu verweisen, ist dabei das Beispiel, das der Therapeut im konkreten Kontakt mit seinem Klienten liefert, indem er die Dynamik seiner seelischen Reaktion bei der Interaktion simultan offenlegt. Die maximale Kommunikation entspricht in der Therapie wie anderswo maximaler Transparenz. Dem Therapeuten geht es um das Verständnis der seelischen Regeln im kommunikativen Prozess, deren sinnvolles Gefüge man im reflektierten Dialog erkennt und nach deren Erkennen man mit der eigenen Biographie einverstanden ist. Eine gelinde Form der Unterwerfung empfiehlt der Therapeut daher nur unter die Aha's der Selbsterkenntnis; also einer Herrin, deren Anspruch den Unterworfenen in die Höhe beugt.
Der brave Pfarrer versucht so zu sein, wie er sollte, der gute Therapeut, bloß wie er ist. Der Pfarrer empfiehlt, Teilen der Wirklichkeit aus dem Wege zu gehen, weil man daran Schaden nehmen könnte. Der Therapeut hält es für besser, sich der ganzen Wirklichkeit zu stellen. Der Pfarrer sucht die eigentliche Macht im Himmel abstrakter Ideale, während sich das Interesse des Therapeuten auf die konkrete Innenseite der Realität bezieht.
Von großer Wichtigkeit für die Therapie ist die Fähigkeit des Therapeuten, nonverbale Signale zu verstehen. Durch die charakteristische Haltung, mit der der Klient stereotyp seiner Umwelt begegnet, strukturiert er seine Kontakte nämlich so, dass darin nur ein Teil seiner tatsächlichen Individualität unverstellt erscheint. Der andere Teil wird schamhaft verborgen oder ganz übersehen, denn was nicht in einer konkreten Beziehung mitteilbar ist, entgeht leicht sogar der Aufmerksamkeit dessen, der es verschweigt. Meist betreibt der Klient zusätzlich einen sekundärer Aufwand, um die vermeintlich unkommunizierbaren Aspekte des Seelenlebens am Ausdruck zu hindern, da er fürchtet, derlei Aspekte würden seine bereits brüchige Integration in die Gemeinschaft weiter gefährden. Durch vielfältige Manöver zur Abwehr ausgeblendeter Impulse wird seine Fähigkeit, kreativ und unbefangen zu begegnen, eingeschränkt. Da der Klient gefürchtete Impulse ausblendet, hat er nur ein lückenhaftes Bild seiner selbst. So weiß er nur ungenau, was er vom Leben tatsächlich will. Die ausgeblendeten Anteile werden aber als nonverbale Haltung und spezifische Verfärbung des Kontaktverhaltens ausagiert und zwar um so stärker, je weniger sie verstanden sind. Die Aufgabe des Therapeuten ist es dann, aus dem Verhalten bereits herauszulesen, was der Klient noch nicht sagen kann. So erahnt der Therapeut oft schon bei der ersten Begegnung - wenn noch nicht mehr als ein paar Sätze gesagt sind - die wesentlichen Aspekte der Störung. Dabei achtet er auf Gestik, Mimik und Kleidung, auf Sprachmelodie und Tonfall dessen, was der Klient als erstes sagt. Und er achtet darauf, wie seine eigene Psyche bildhaft und emotional vor jeder abstrakten Formulierung einer Antwort auf diesen konkreten Menschen reagiert.
Die zweite Schiene der Kommunikation beruht nicht auf dieser analogen Intuition, die sich auf die Atmosphäre, die der Klient um sich verbreitet, einschwingt. Die zweite Schiene nimmt vielmehr ernst, was der Klient wortwörtlich sagt. Sie geht davon aus, dass jeder Mensch mehr über sich ausspricht, als er selbst weiß. Dabei greift der Therapeut prägnante Wörter und ganze Sätze des Klienten immer wieder auf. Er bereichert die Bilder, die sich daran knüpfen, nicht nur indem er den Klienten zur freien Assoziation ermutigt, sondern durch die eigene und zielgerichtete Analyse dessen, was im Wort und im Satz zusätzlich ausgesagt wird, wenn man unter der üblichen Bedeutung nach Obertönen und paradoxen Widersprüchen sucht. Ein Vorteil dieser "Technik" ist, dass der Therapeut selbst gibt, statt immer neue Einfälle von seinem Klienten zu fordern. Der Therapeut lässt nicht nur Freiraum, sondern er füttert und hat selbst Biss.
Der Patient geht zum Arzt, weil er Beschwerden hat. Er beschwert sich, dass ihn Symptome plagen. Den Arzt wählt er als Beschwerdestelle, weil ihm selbst die Möglichkeit fehlt, die Symptome zu beheben und weil er davon ausgeht, dass der Arzt eine Fachautorität ist, die ihm aus einer fürsorglichen Haltung heraus schon helfen wird. Die Hilfe, die er erwartet, soll ihn heilen, während er selbst dabei weitgehend passiv bleibt. Das Kompetenzgefälle zwischen ihm und dem "Doktor" bleibt auch nach der Heilung bestehen.
Der Anlass, aus dem ein Klient zum Psychotherapeuten kommt, sind ebenfalls Beschwerden und Symptome. Ursache seiner Beschwerden sind aber keine fassbaren Krankheitsursachen, die ihn, unabhängig von dem, was er selbst tut, quasi von außen in die Seele zwicken und die ein geübter Seelenarzt herausschneiden könnte, wenn die Psyche solange stillhält, sondern, was ihn untergründig plagt, ist, dass er im Kontakt und in der Einbindung zu seiner Umwelt kein ganzer Mensch sein kann. Das Problem des Psychotherapiepatienten ist also nicht, dass er wie der körperlich Kranke als Opfer von schädlichen Wirkungen befallen wird, sondern dass er etwas nicht kann, was seinem Wesen angemessen wäre. Das Problem des Klienten ist mangelndes Können und kein Befallensein.
In legitimer Vereinfachung lässt sich sagen, dass der Klient "kein ganzer Mensch" sein kann, weil er sich wie ein hilfloses Opfer des Übels über den Mißstand bloß beschwert, statt ihn durch ein Einstehen für sich selbst in der Begegnung zu beseitigen. Legitim ist diese Vereinfachung, weil das Einstehen für das ganze Selbst tatsächlich als zentrales Heilmittel psychogener Pathologien genannt werden kann, stark vereinfacht wird das Problem, weil die Aussage die vielschichtigen Probleme zwischen Sein und Bewusstsein verschweigt und das differenzierte Problembewusstsein scheinbar durch einen moralischen Appell ersetzt.
Während der Arzt in aller Regel jedenfalls am körperlichen Symptom oder am isolierten Organbefund ansetzen darf reicht es für den Therapeuten nicht, sich mit Hilfe seiner "Techniken" - zum Beispiel der Deutung, der Suggestion oder der Konditionierung - im seelischen Apparat des Patienten zu schaffen zu machen, als wäre dieser Apparat eine abgeschlossene Gestalt, analog dem defekten Motor eines Lieferwagens. Vielmehr ist es die Aufgabe des Therapeuten, den "ganzen Menschen" in seiner existentiellen Verwobenheit mit der Umwelt als Behandlungsziel zu sehen. Da es also letztlich um ein Menschsein-Können geht, zielt die Psychotherapie auf keine passive Behandlung ab, sondern auf eine autonome Aktivität des Klienten. Der Klient lernt in der Therapie wie er sich in seinem Beziehungen selbst verwirklicht. Anders als wenn es um einen entzündeten Blinddarm geht, gehört zur Psychotherapie daher auch, dass sich das Kompetenzgefälle - betreffs der Fähigkeit zur kreativen Kommunikation - zwischen Therapeut und Klient vermindert. Die Kompetenz, die dabei vermittelt wird, ist die, sich authentisch und vorbehaltlos in fruchtbare(n) Beziehungen zu erleben.
Was für ein gleichermaßen verführerischer und verfänglicher Begriff! Und doch ist er zur Konzeption einer Psychotherapie, die mehr erhofft, als die schnellstmögliche Beseitigung lästiger Symptome notwendig. Selbst wenn ein Klient nämlich mit eben diesem Ziel zum Therapeuten kommt und vordergründig nichts anderes will, als sich seiner Symptome zu entledigen, ist es für das Gelingen der Therapie wichtig, dass der Therapeut den Klienten als einen "ganzen Menschen" empfängt. Denn hinter jeder Psychopathologie steckt tief verborgen die uralte Sehnsucht, als ganzer Mensch in einer realen Begegnung empfangen zu sein.
Verfänglich ist der Begriff, weil er dazu führen kann, sich unklarer Verbrüderung und Schwärmerei zu überlassen, wenn er in sülziger Sentimentalität dazu verleitet, sich ohne Tiefgang gegenseitig den besonderen Wert des Menschseins zu bestätigen. Dann gefährdet er die Begegnung und deren therapeutische Wirksamkeit, indem der Mut zur Gegnerschaft im Rahmen einer ganzen Beziehung in ritualisierter Nettigkeit zu ertrinken droht. So etwas ist keine Therapie, sondern wechselseitige Beziehungskorruption. Jede echte Gemeinsamkeit braucht in sich selbst den Gegensatz.
Verführerisch ist der Begriff, wenn er ohne platte Idealisierung der Hypothese folgt, dass das wahre Potential des unverkorksten Menschen das, was üblicherweise davon verwirklicht ist, um Qualitäten übersteigt - und das tut es in der Tat! Wenn in der Therapie ein Klima geschaffen wird, das die Entfaltung des ganzen Potentials begrüßt, kann im Sog der verführerischen Phantasie das, was vom Ideal verwirklicht werden kann, entstehen. Ohne das Charisma eines utopischen Ideals, das gleichzeitig von einem nüchterem Realismus ins Pragmatische eingebunden wird, ist therapeutischer Fortschritt zwar möglich; doch kommt er vergleichsweise mühsam von der Stelle.
Die Psychotherapie braucht daher ein Konzept vom "ganzen Menschen", das zwischen Skylla und Charybdis erfolgreich manövriert. Wird das Konzept zu sachlich, will es ausschließen, was das Sichtbare und Nützliche übersteigt, dann droht es am Felsen der Profanität zu zerschellen, schwärmt es zu viel, dann ersäuft es im Strudel seiner hehren Ziele.
Die Wirksamkeit des therapeutischen Dialoges wird durch das besondere Verhältnis zwischen Klient und Therapeut gefördert. Beide begegnen sich nicht als Kollegen am Arbeitsplatz oder als Teilnehmer an einem Malkurs in der Toskana und sie vereinbaren ihre weiteren Treffen auch nicht, weil sie sich zufällig sympathisch genug sind, eine gemeinsame Freizeit zu gestalten und halt `mal sehen wollen, was sich aus all dem entwickelt. Die therapeutischen Treffen haben vielmehr ein klar umrissenes Thema: den Klienten, seine Symptome und wie er sich samt seinen Symptomen so durchs Leben schlägt.
Es gehört zum Wesen der Kontaktstörungen, dass ihre Auffälligkeit mit der Nähe und der Intensität des Kontaktes steigt. Und je auffälliger sie werden, desto mehr stören sie. Da sich Therapeut und Klient im sonstigen Leben nicht begegnen, bleiben sie zueinander in so viel sicherer Distanz, dass der störende Einfluss ihrer beider Kontaktstörungen weniger zum Tragen kommt, als dies der Fall wäre, wenn sie auch anderweitig im Leben etwas miteinander zu schaffen hätten. Durch diese Distanz kann in der therapeutischen Begegnung mehr Wahrheit angstfrei riskiert werden, als anderswo. Psychotherapie ist ein Single-Abenteuer-Urlaub der zwischenmenschlichen Kommunikation. Dort kann man auch mal anders sein, als im Umfeld derer, mit denen man zuhause in engeren Symbiosen lebt.
Aus der Tatsache, dass es in der Therapie primär um das Wohl des Klienten geht, hatten unverbesserliche Puristen in der Vergangenheit geschlossen, dass es den Therapeuten als Person im therapeutischen Prozess am besten gar nicht gäbe, da seine Gegenwart den Klienten dabei behindere, "wirklich" zu sich selbst zu finden. Und da es den Therapeuten nun doch `mal gibt, sollte er zumindest so tun, als gäbe es ihn nicht. Damit war die sogenannte "Abstinenzregel" der analytischen Therapie aus der Taufe gehoben. Sie besagt, dass der Therapeut sich der Präsenz enthalten sollte.
Was die Puristen zu ihrer extremen Forderung trieb, war die Furcht, der Therapeut könne durch seine erkennbare Präsenz die assoziative Selbstfindung des Klienten so aus der Bahn lenken, dass sich der Klient am Ende nicht von den eigenen, sondern den Neurosen eines entfremdeten Ichs befreit und geblendet von einem scheinbaren Erfolg an falscher Stelle auf den echten Problemen sitzenbleibt. Diesem Denken haftet insgeheim ein einseitig partikuläres Konzept der Person an, die man zwar per Milieutheorie von überall her beeinflusst sieht, der man in der Therapie dann aber so begegnet, als gebe es die eine Person, die man in atomistischer Reinheit finden könne, indem man sie aus dem konkreten Kontakt herauslöst.
So frönte die frühe Psychologie einem Objektivismus, der die Subjektivität und die prozessuale Vernetzung ihres Sujets in den sozialen Kontext unterschätzte; was man verstehen kann, wenn man die junge Wissenschaft der Psychologie als ein Kind des 19. Jahrhunderts betrachtet, eines Jahrhunderts also, in dem Sir Conan Doyle Sherlock Holmes erfand, eine Figur, in deren Phantasie die Wege des menschlichen Geistes vollständig von den monokausalen Gedanken eines naiven Rationalismus erfasst werden können.
Im Gegensatz dazu wird hier die Hypothese vertreten, dass das Ich viel zu sehr dialogisch ist, als das es im dialogfeindlichen Klima der klassischen Analyse große Chancen hätte, seine wesentlichen Themen rasch zu finden. Statt der Abstinenz empfiehlt sich daher die Transparenz. Der Therapeut sollte sich nicht im dialogischen Off seinen Teil denken und das Erdachte dann vieldeutig verschweigen. Die Gedanken, Impulse und seelischen Reaktionen des Therapeuten sind nämlich gerade das, wonach das nach echtem Dialog dürstende Ich des Klienten sucht und mit dessen Hilfe es jenen Teil von sich selbst tatsächlich finden könnte, den es anderswo bisher nicht fand. Was der Klient braucht - und zwar desto mehr, je größer seine Probleme sind - ist ein Therapeut, der seine Person nicht unterschlägt, sondern der sie offen und ehrlich im therapeutischen Prozess zur Verfügung stellt. Was der Mensch im allgemeinen braucht und was den Kranken im besonderen heilt, ist ein Gegenüber, das den Mut hat, sich bejahend und ohne taktische Winkelzüge, die in der "normalen" Kommunikation nur allzu selbstverständlich sind, zu offenbaren.
Es gehört zu den größten Unsitten in der Therapie, dem Klienten Fragen zu stellen, die gar keine sind. Echte Fragen werden gestellt, um Unbekanntes zu erfahren. Echte Fragen gehen von einer Wissenslücke aus, die der Therapeut in sich wahrnimmt, und echte Fragen wollen tatsächliche eine Lücke schließen.
Beim unechten Fragen geht es im Gegensatz dazu darum, den Patienten zu verführen. Er soll jene Antwort geben, für deren Richtigkeit sich der Therapeut in seiner Schweigsamkeit bereits entschieden hat. Er soll glauben, dass richtig ist, was den Therapeuten zufriedenstellt. Hier tut der Therapeut nur so, als ob er etwas wissen wolle. In Wirklichkeit meint er aber, er wisse bereits bestens Bescheid, um über den Kopf des Klienten hinweg zu entscheiden, wohin er dessen nächsten Schritt führen soll. Nun ist es zwar durchaus legitim zu glauben, man wisse Bescheid, doch statt die eigene Sichtweise als eine Aussage in den Raum und zur Diskussion zu stellen, versucht der Therapeut aus dem dialogischen Off den Patienten durch "geeignete" Fragen zur Bestätigung seiner Ansicht zu bewegen. Was der Therapeut durch diese Technik zu vermeiden versucht, ist das Risiko, eventuell Irrtümer und Ungenauigkeiten in seiner Beurteilung der psychologischen Zusammenhänge eingestehen zu müssen. Womöglich fürchtet er gar, die Autorität seines Expertentums werde durch begründbare Zweifel untergraben, was darauf schließen lässt, dass er die suggestive Wirksamkeit der "Droge Arzt" für wichtiger hält, als das, was der Arzt über das Wesen des Leidens tatsächlich herauszufinden vermag. Hinter dem Mangel an Transparenz ist der verleugnete Selbstwertzweifel des Therapeuten zu spüren und was sich als professionelle Abstinenz verkleidet ist oft bloß der mangelnde Mut zu dialogischer Präsenz.
Der Therapiestil dieser wohlgemeinten Manipulation vermeidet die echte Begegnung und hofft, man könne in der Therapie Klarheit schaffen, indem man kommunikativ im Trüben fischt. Rationalisiert wird diese Haltung durch die These, der Therapeut solle "nondirektiv" sein, damit der Klient bei der Erkundung seiner seelischen Motive "von allein darauf kommt". Sonst blieben die Erkenntnisse nämlich bloße Kopfgeburten, die ihm der Therapeut am Bauch vorbei ins Hirn pflanze und die dort prompt dem Intellektualisieren - also einer oberflächlichen und nutzlosen Verstandestätigkeit - als wehrlose Beute zum Opfer fielen; was zwar tatsächlich passieren kann, jedoch am ehesten dann, wenn die Erkenntnisse, die der Therapeut frontal ausspricht, nur Konserven sind und nicht der originären Begegnung mit dem konkreten Klienten entspringen. Tatsächlich kommt der Klient aber gerade deswegen zum Therapeuten, weil er selbst nicht "von allein darauf kommt". Deshalb bedarf die Forderung nach dem "nondirektiven" Stil der Differenzierung. "Nondirektiv", also "nicht-richtungweisend", ist ein Therapeut im Grunde nie. Warum auch? Der in seine Entscheidungsprobleme verirrte Klient kommt schließlich deshalb, weil er von Therapeuten eine Richtung gewiesen haben will. Der kluge Therapeut weist aber keine Richtung, indem er über die Probleme des Klienten entscheidet oder ihn gar zu irgendwelchen Taten drängt, sondern er weist den Klienten auf jene ungeklärten seelischen Konflikte hin, deren Klärung seine Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit vermutlich verbessern wird. Und beim Hinweis auf die relevanten psychologischen Probleme, deren Benennung dem Therapeuten durch seine Berufserfahrung leichter als der Allgemeinheit fällt, ist es am effektivsten, klar und deutlich in jene Richtung zu weisen, die der Fachmann für richtig hält. Hier macht es keinen Sinn, um den heißen Brei herumzureden und dem Klienten mit verstohlenen Fragen tastende Antworten zu entlocken, denn die klare Stellungnahme des Therapeuten hat die beste Chance, der Abwehr des Patienten trefflich zu entgehen, oder im kreativen Widerspruch zur Formulierung der zutreffenden Antithese fruchtbar gemacht zu werden.
Die wohlgemeinte Manipulation verstößt gegen das Kriterium der Ebenbürtigkeit, weil dem Hinlenken durch die Technik der angeblichen Frage etwas Geringschätziges anhaftet. Der Therapeut tut dabei so, als könne man das Ich des Klienten nicht als einen vollwertigen Kommunikationspartner ansprechen, der in der Lage ist, von sich Abstand zu nehmen, um sich aus dem Abstand heraus gemeinsam mit jemandem zu betrachten. Stattdessen erwartet ein solcher Therapeut, dass sich der Klient ihm blind anvertraut; jedenfalls blinder, als es sein müsste.
Angeblich ist die Weitergabe tiefenpsychologischer Anschauungen (griechisch: Theorie) kontraproduktiv, da sie bloß zum besagten "Intellektualisieren" führe. Das stimmt aber nur, wenn man sich dabei des esoterischen Vokabulars der Psychoanalyse bedient. Übersetzt man das, was die Analyse der Menschenseele seit Jahrtausenden an Weisheiten zutage gefördert hat jedoch in eine kraftvolle Sprache, dann versteht und berührt das jeden, der so viel Grips im Kopf hat, dass er überhaupt eine Therapie machen will. Es ist daher zu vermuten, dass ein Therapeut, der seine eigenen kognitiven und emotionalen Prozesse innerhalb des therapeutischen Dialoges nicht transparent macht - sondern im stillen Fragen formuliert, die den Klienten dann zum Guten führen sollen - dadurch seinen Kompetenzvorsprung beim Verständnis psychologischer Dynamik sichert, was dem Kontaktmerkmal "Ebenbürtigkeit" zuwiderläuft. Das 'Ich sehe 'was, was Du nicht siehst' ist ein Gesellschaftsspiel. In der Therapie hat es nichts zu suchen. Er guter Therapeut intrigiert nicht gegen die Neurose. Er er fordert sie zum Duell heraus.
Verstoßen wird gegen das Kriterium der Gegenseitigkeit, weil sich der Therapeut zwar das Recht vorbehält, die intimsten Gedanken des Klienten auszuspähen, er sich selbst gegen Einblicke in die Ereignisdynamik seines innerpsychischen Feldes jedoch professionell abschirmt. Die Kommunikation wird so derart asymmetrisch, dass man die wichtigsten Heilkräfte der Begegnung blockiert.
Verstoßen wird auch gegen das Kriterium der Begrenzung, weil die einzig reale Grenze, auf die das Ich im Dialog tatsächlich stößt, das konkrete Du des Gegenübers ist und weil jede gesunde Kommunikation auf die Sichtbarkeit dieser Grenze angewiesen ist. Landläufig ist die These, man müsse den Klienten mit sich selbst - also den Klienten mit dem Klienten - konfrontieren, man müsse ihn "spiegeln", als sei der Therapeut der Handspiegel beim Friseur, mit dem die unsichtbaren Hände dieser Selbstkonfrontationstheorie um den Kunden kreisen, damit der mal sieht, wie er hinten 'rum ausschaut. Dabei ist doch völlig unklar, wie der Therapeut seine Person so gründlich aus dem Spiegelkabinett der Therapie herausputzen soll, dass der Klient im Spiegel nur sich selbst, aber nichts vom Therapeuten erkennt.
Womit der Klient vom Therapeuten tatsächlich zu konfrontieren ist, ist nicht sein unverzerrtes Spiegelbild, das er in Wirklichkeit nämlich nur soweit sehen kann, wie er ohne Skrupel sich selbst reflektiert. Aber er kann und soll mit der ehrlichen seelischen Reaktion des Therapeuten konfrontiert werden und mit dem, was dieser dank seiner Erfahrung in der Analyse menschlicher Seelenmotive an qualifizierter Betrachtung der Sinnzusammenhänge zustande bringt. Die Chance der Therapie liegt nicht im virtuellen Solipsismus des Klienten, sondern in einer qualitativ hochwertigen und thematisch vertieften Kommunikation, so wie man sie im Alltag leider viel zu selten antrifft.
Da Individuen keine isolierten Partikel sind, deren Werden sich in einer abgeschlossenen Dynamik erschöpft, als seien sie einsam kreisende Planeten im Weltall, ist es für ihre Weiterentwicklung höchst sinnvoll, dass ein gutes Angebot integrationsfähiger Sichtweisen bereitsteht, aus dessen Fundus der einzelne am besten selbst auswählen sollte, was er tatsächlich integrieren will. Hier ist es letztlich wie beim Essen. Selbständigkeit beruht auf der bewussten Auswahl der Speisen, die man sich einzuverleiben gedenkt und es besteht gar kein Anlass, der eigenen Zunge so zu misstrauen, dass man die Entscheidungen lieber einem Diätkoch überträgt. Wenn selbständiges Entscheiden und die Übernahme der Verantwortung denn so hohe Therapieziele sind, wie man sie in Therapeutenkreisen handelt, warum sollte man dann dem Klienten nicht die Rezepte verraten, nach denen man die Suppe seiner Arbeitshypothesen kocht. Wenn man hierbei die eigene Denkweise als sinnvolle Alternative anbietet, kann der Klient am leichtesten integrieren, was ihm davon tatsächlich bekommt; oder im möglichen Widerspruch dagegen kann er selbst entdecken, wovon er bisher nichts wusste.
Diese offene Bereitstellung integrierbarer Sichtweisen ist es auch, was das Wesenskriterium "Integration" mit Leben erfüllt. Denn das Ich kann seine wahre Integrität nur im realen Kontakt zum Du entdecken. Konkret bedeutet das, das der Therapeut den Klienten nicht bloß mit fertigen Thesen konfrontiert, sondern dass er ihm die Abfolge seiner Schlüsse - inklusive dessen, was er dabei als seine eigenen Anteile erkennt - offenlegt. Indem er das tut, hat er selbst die beste Kontrolle darüber, dass seine Schlussfolgerungen keine unreflektierten Konstrukte sind, die weniger mit der Sache des Klienten zu tun haben, als dass sie Ausdruck einer unverstandenen Eigenproblematik des Therapeuten sind. Sind die Verknüpfungen seelischer Motive, die der Therapeut auf diese Weise zu einem kohärenten Sinngeflecht zusammenwebt, plausibel, dann gewinnt er durch seine transparente Vorgehensweise beim Klienten stark an Überzeugungskraft. Erstens, weil das tiefenpsychologische Denken verstehbar wird und es die Aufmerksamkeit des Klienten in seinen Bann zieht. Zweitens, weil die Überprüfbarkeit das Misstrauen und damit so manche störende Abwehr des Klienten entkräftet. Und zum Dritten führt die Transparenz dazu, dass der Klient etwas von den Kochkünsten des Therapeuten lernt und so besser in die Lage versetzt wird, das Werkzeug der Introspektion selbständig im Alltag zu verwenden. Therapeutische Prozesse werden durch all dies oft erheblich beschleunigt. Therapie und Begegnung gewinnen an Intensität.
Die Existenz der Psychopathologie ist ein schlagkräftiges Argument für die These, dass das Individuum mit seinem grundlegenden Wesen in einer transpersonellen Wahrheit verankert ist. Rein biologisch betrachtet hätte ein einzelner Mensch einen klaren Selektionsvorteil, wenn seine psychischen Funktionen beliebig an die jeweiligen Lebensbedingungen anzupassen wären, ohne dass es dabei in seinem Inneren zu störenden Spannungen käme, die seine soziale Durchsetzungsfähigkeit beeinträchtigen würden. Anders gesagt: gäbe es Menschen von absoluter Skrupellosigkeit, deren Wesen in nichts etwas anderem verpflichtet wäre, dann würden sie die Menschheit auf Dauer vollends beherrschen.
Ein Soziologe könnte nun einwenden: Schon, schon, aber darf man denn vergessen, dass das Individuum ein menschliches Herdentier bleibt und deshalb Selektionsvorteile hat, wenn seine Psyche - ähnlich wie ihm selbst - auch der Gemeinschaft, in der es lebt, verpflichtet bleibt, sodass sein Altruismus das Gedeihen der Gemeinschaft fördert und ihm selbst daher als Teilnehmer dieser Gemeinschaft nützlich ist? Nein, vergessen sollte man das nicht, aber das Studium der psychopathologischen Seelenzustände zeigt, dass die Seele Prioritäten setzt, die auf die Vormachtstellung einer Ethik hinweist, die sowohl das egoistische als auch das gemeinschaftlich-solidarische Motiv übersteigt.
Trüge der Mensch nur die beiden Motive "Eigennutz" "Gemeinschaftssinn" in seiner Seele, hätte er es erheblich leichter. Zwar käme es auch dann intrapsychisch zu Interessenskonflikten, die Leiden verursachen könnten, doch akzeptable Kompromisse ließen sich leichter finden. Die Skrupellosen würden die Menschheit durch ein Netz pragmatischer Gemeinschaftswerte beherrschen. Es entstünde ein unerschütterlicher Protestantenstaat, weil die Skrupellosen begriffen hätten, das es für sie am nützlichsten ist, die anderen entmündigt aber fürsorglich zu führen.
Psychopathologische Zustände, die als sogenannte Neurosen oder Persönlichkeitsstörungen dauerhaft bestehen bleiben oder sich im Laufe des Lebens gar verstärken, beruhen darauf, dass profane Kompromisse auf der Ebene "Eigennutz versus Gemeinschaftssinn" deshalb nicht vereinbart werden, weil die transpsychosoziale Ebene ihr Veto gegen eine solche Kumpanei der Egos einlegt. Weil dieser Ebene, dass heißt dem Bezug des Individuums zu einer Wahrheit jenseits partieller Interessen eine so große Bedeutung bei der Steuerung seelischer Funktionen zufällt, nimmt es die Psyche lieber inkauf, ein Leben lang zu leiden, als von ihrem meist unbewussten Bündnis mit dem Absoluten vollends abzuweichen. Der Preis, den eine Seele für diesen Bezug zur Wahrheit zu zahlen bereit ist, ist offensichtlich hoch. Es lässt sich vermuten, dass das Ausmaß, durch den diese Ethik die Psyche bereits vor der Bildung eines reflektiven Bewusstseins bestimmt, ähnlich groß ist. Nur unter Berücksichtigung dieser Hypothese läßt sich erklären, warum Menschen unter den Folgen einer traumatischen Sozialisation oft ein Leben lang leiden. Und gleichzeitig ist die Existenz seelischen Leidens ein Beweis der Wahrheit.
Die Kompromissbildung zwischen den Impulsen des egozentrischen Eigennutzes und der sozialen Loyalität ist zwar ein zentrales Thema der seelischen Entwicklung und der Mensch kann die Form der Kompromisse grundsätzlich frei bestimmen, doch nicht ohne dass seine Wahl Konsequenzen nach sich zöge, die im ungünstigen Fall zu seelischem Leiden führen. Dies weist darauf hin, dass das Ist der Kompromissbildung mit einem Soll verglichen wird. Je größer die Abweichung dann ist, desto größer ist auch die unbestimmte Spannung, die intrapsychisch wirksam wird und die auf den Ausgleich drängt. Die ursprüngliche Konfliktspannung, die zur Neurose führt, entsteht also nicht nur zwischen Eigennutz und Gemeinschaftssinn, also nicht nur zwischen den Instanzen Es, Ich und Über-Ich, sondern sie entsteht zwischen dem realisierten Kompromiss der unterschiedlichen Impulse und seinem Soll, das mehr oder weniger bewusst ist. Genau besehen sind der direkte Egoismus mit rücksichtslosem Ellenbogen und die geschmeidige Bereitschaft zur sozialen Anpassung nicht so unterschiedlich, wie man es aus der Nähe betrachtet meinen kann. Aus größerem Abstand erkennt man, dass beide letztlich auf den individuellen Vorteil abzielen und sich bemühen, im kleinen Horizont dieses Vorteils den großen Rest des Daseins einzuordnen. Die Ziele sind weitgehend gleich, nur in Strategie und Taktik sind die Ansätze unterschiedlich. Solange sich der einzelne jedoch nicht aus der halbherzigen Wahl zwischen beiden Möglichkeiten befreit, wird er für neurotische Pathologien anfällig bleiben, weil das Ego, dass direkt oder indirekt auf seinen Egoismus zentriert bleibt, nie die Freiheit finden kann, sich ganz über den nahenden Tod zu erheben. Wie ein Gnom beim Hochsprung watschelt es zögernd auf zwei zu kurzen Beinen der gefürchteten Latte entgegen, wobei es durch sein Watscheln niemals den Schwung bekommt, um unterwegs von aller Sorge befreit daran zu glauben, dass man am Ende die Latte überfliegen und nicht bloß darunter untergehen kann.
Die Eigenart des Individuums, die als dessen ureigenste Art alle Unterschiede nebensächlich macht, ist die Tatsache, dass das Individuum einen jeweils besonderen Platz einnimmt, von dem aus es in einzigartiger Weise die Welt wahrnimmt und ihr so begegnet. Sofern die Ethik fordert, dass das Individuum seiner eigenen Art entspricht, heißt das: Der Mensch ist nur dann mit sich stimmig, wenn er es wagt, die Welt so zu sehen, wie sie aus seiner Perspektive tatsächlich zu erkennen ist. Echte Stimmigkeit wird dabei nur erreicht, wenn das kognitive Erkennen nicht als intellektuelle Simulation von der faktischen Haltung dieser Welt gegenüber abgespalten bleibt. Die Ethik fragt immer, ob das Verhalten eines Menschen mit seinem Weltbild und mit seinen tatsächlichen Lebensumständen in Übereinstimmung ist. Dabei ist im Regelfall aus jeder individuellen Perspektive heraus erkennbar, dass individuelle Perspektiven generell - und so auch die eigene - eben bloß Perspektiven sind und dass das eigene Weltbild somit immer relativierbar bleibt. So fordert die Ethik zwar, zu dem zu stehen, was man von sich aus als wahr erkennt, sie fordert aber auch, sich nicht einseitig in die eigene Sichtweise zu verrennen. Sie fordert, zu sagen, was man sieht und zu hören, wie es die anderen tun. Und sie fordert, aus der eigenen Perspektive heraus zu handeln und zu der Ansicht zu stehen, für die man sich entscheidet.
Der Begriff "Ethik" entstammt einer indoeuropäischen Wurzel. "Suédhos" lässt sich gut mit "Eigenheit, Eigenart" übersetzen. "Ethisch" heißt eigentlich "der eigenen Art entsprechend". Folglich findet das Individuum Antworten darauf, ob sein Verhalten ethisch richtig ist oder falsch, grundsätzlich nur in sich selbst. Erst beim Blick nach innen stellt es fest, ob etwas seiner eigenen Art entspricht. Das Sein des Individuums ist stets ein aktiver Bezug zur Welt. Ethisch richtig ist das Verhalten, wenn es mit dem Sein dessen übereinstimmt, der es als aktiven Bezug von sich zur Welt ausführt.
Die seelische Instanz, die über derlei Fragen entscheidet, wird von altersher als "Gewissen" bezeichnet. Das Gewissen ist die Versammlung dessen, was ein Bewusstsein über sich und die Welt weiß und die aus diesem Wissen heraus vom Individuum verlangt, 'nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden'.
Das "Gewissen" bezeichnet etwas anderes als der moderne Begriff des "Über-Ichs". Das Über-Ich vergleicht die Ziele und Wünsche des Individuums nicht mit den Erfordernissen seiner "eigenen Art", sondern mit den Normen des sozialen Umfeldes und es entscheidet folglich nicht darüber, ob etwas ethisch richtig ist, sondern, ob es der geltenden Moral entspricht. Der primäre Blick auf der Suche nach der richtigen Moral richtet sich nicht nach innen, sondern er hält Ausschau, was im Umfeld des Individuums gerade mal Sitte ist. Das Über-Ich ist eine Erinnerung daran, was man früher schon einmal beim Blick nach außen als "sittlich" und "der Moral gemäß" erkannt hat.
"Sitte" stammt etymologisch aus der gleichen Quelle wie die Wörter "Saite" und "Seil". Der gemeinsame Ursprung weist darauf hin, das "sittlich" eigentlich "verbindlich" heißt. Ein sittliches Verhalten verbindet mit dem Umfeld, ein unsittliches führt zum Ausschluss aus der Gemeinschaft, die bestimmte Sitten für sich als verbindlich definiert hat.
Das Wort "Moral" schließlich ist ein Abkömmling der indoeuropäischen Wurzel "mo- = starken Willens sein". In diesem Sinne spricht es von Regeln, die ein starker Wille durchsetzt. Die Moral ist daher immer einer "irdischen" Macht verpflichtet, deren Statthalter im Individuum "Über-Ich" heißt und deren mächtige Ansprüche als jeweils geltender kultureller Sittenkodex wirksam sind. Je nach politischem System ist die irdische Macht dabei mehr oder weniger in Einzelpersonen zentriert. So sind moralische Entscheidungen jenem sozialen Umfeld gegenüber loyal, dessen Wertehierarchie sich ein Individuum mit dem Ziel unterwirft, sich durch Anpassung Vorteile zu verschaffen und den Nachteilen des Abweichens aus dem Wege zu gehen.
Zwar weist die Moral über den Horizont des Egos hinaus, doch anders als es die Ethik tut. Die Ethik sucht Übereinstimmung mit der 'Eigenart der Individualität', während sich die Moral um eine Loyalität zum sozialen Umfeld bemüht. Die 'Eigenart der Individualität' darf nicht mit dem willkürlichen Gutdünken eines Individuums gleichgesetzt werden. Vielmehr wird jedes Individuum durch das Faktum der vorgegebenen Perspektivität und der darin vorgegebenen Möglichkeit zur Wahrhaftigkeit an eine transpersonelle Wahrheit gebunden. Nicht in der Freiheit zu willkürlicher Beliebigkeit liegt die Chance des einzelnen, sondern in der Freiheit, die einzige perspektivische Wahrhaftigkeit zu wählen, in der seine Individualität mit dem Kosmos stimmig ist.
So weist die Ethik mehr als die Moral über das hinaus, was dem Individuum vordergründig von Interesse ist - und doch erreicht das Individuum erst im ethischen Anspruch ganz sich selbst. Da Menschen grundsätzlich derselben Wahrheit verpflichtet sind, gibt es zwischen Moral und Ethik Gemeinsamkeiten. Im besten Falle, wenn es also viele Gemeinsamkeiten sind, ist Moral jedoch bloß eine Ethik von der Stange. Sie ist eine passable Konfektion abstrakter Werte, die sich jeder überziehen kann, damit er nicht nackt ist. Im schlimmsten Falle allerdings ist die Moral ein Instrument der Macht, denn sie taugt als Knebel und als reines Gift. Während die Ethik das Individuum wie ein Vertebratenskelett von innen trägt, bleibt die beste Moral ein Panzer aus Chitin. So stellt die Ethik als Regelwerk der Werte einen höheren Anspruch an das Individuum als die Moral, weil sie im Gegensatz zur Moral über die soziale Einbindung hinausgeht und als Lohn der Angst eine Freiheit gewährt, die der Moral als Preis für den Schutz, den sie gibt, geopfert werden muss.
Illustrieren lässt sich der Unterschied ganz einfach: Je nach kultureller Zugehörigkeit ist es unmoralisch Milch und Fleisch vermischt zu essen, Alkohol zu trinken, Kühe zu schlachten, der Polygamie zu frönen oder sich nackt im Spiegel zu betrachten. Ethisch relevant sind diese Fragen aber nicht per se. So bleiben die Moralisten der Zeit und dem Erdkreis treu, in dem sie auf ihre Regeln schwören, doch sie haben Schwierigkeiten, sich über die Grenzen hinweg zu verstehen. Die Ethik ist eine Über-ein-stimmung mit den Erfordernissen der Individualität ohne ohnmächtiges Mit-schwingen im Konzert individueller Interessen zu sein. So wie Individualität als besonderes Phänomen alle kulturellen Interpretationen ihres Themas übersteigt, so übersteigt auch jene Haltung, die ihrem grundlegenden Wesen entspricht - nämlich die Ethik - alle kulturellen Unterschiede, die zur Zwietracht reizen.
Das Individuum kann sich nur soweit unbefangen auf die Welt einlassen, wie es gleichzeitig seiner ursprünglichen Herkunft als eine Emanation der Wahrheit treu bleibt. Im gleichen Zuge wie das Individuum in die Welt hinausexistiert, insistiert die Welt beharrlich auf ihrer Forderung, dass die tiefste Binnenstruktur der Psyche dem Geheimnis einer hintergründigen Einheit der Welt entspricht. Diese Insistenz bestimmt das Individuum eindringlich als ethische Vorgabe, deren Regeln es nicht nach Belieben verändern kann.
"Nur soweit unbefangen" meint dabei, dass es beim Übertreten dieser Regeln zu innerseelischen Feed-Back-Mechanismen kommt, die ein weiteres Vorwärtsschreiten in jede falsche Richtung zunehmend erschweren. Falsch ist dabei jede Richtungen, die zu weit von der ursprünglichen Verbindung zwischen Wahrheit, Wahrhaftigkeit und bewusster Perspektive wegführt. Die Mechanismen, die so zum Tragen kommen, tun gemeinerhand in irgendeiner Weise weh, sodass man - unter bewusstem Verzicht auf naiv-patriarchalische Gottesbilder - sagen darf, dass jedem Menschen durch sein "Leben-mit-der-Welt" bereits ein Wirkmechanismus immanent ist, durch den er sich für gewisse Nachlässigkeiten im ethischen Bereich von selbst bestraft.
"Unbefangen" und "wahrhaftig" sind Begriffe, deren nähere Betrachtung sich lohnt. Sie deuten darauf hin, dass die Freiheit der Seele und der Gang der Welt nur als Einheit zu verstehen sind. Unbefangen, also frei von jeder Hemmung, die dem eigenen Wesen nicht ganz entspricht, bewegt sich ein Mensch, wenn er wahrhaftig ist - so lautet hier etwas streng die These. Abgemildert wird die Strenge aber dann, wenn man sich deutlich macht, dass Wahrhaftigkeit, also das der-Wahrheit-verhaftet-Sein, nicht heißt, dass das kleine Ich der großen Wahrheit ganz entsprechen müsste, um nicht bei jedem Straucheln gleich vom Knüppel eines brutalen Gewissens drangsaliert zu werden. Um der Wahrheit verhaftet zu sein, reicht es schon, so zu handeln, wie man es aus eigenem Dafürhalten trotz aller Irrtumsmöglichkeit für richtig hält. Da die Befreiung in die Unbefangenheit einer fehlbaren Individualität jedoch nur zu dem Preis gelingt, wie das Individuum seine grundsätzliche Bindung an das Wahre nicht aufgibt, darf man die Freiheit getrost als gnädige Pflicht bezeichnen.
Der psychologische Konflikt zwischen der Autonomie und der Abhängigkeit des Individuums von seiner Gemeinschaft, hat in der Dialektik zwischen Unbefangenheit und Wahrhaftigkeit einen ontischen Boden. Die Wahrheit ist die Gemeinschaft auf die sich die Freiheit des einen Geistes bezieht.
Die Psychotherapie dient der Befreiung von seelischen Symptomen. So wie das Ich nicht als abgelöst vom Umfeld betrachtet werden kann, so können auch die Symptome, die es plagen nur im aktiven Bezug zur Welt verstanden werden. Da die Freiheit der Seele nur im Kontext ihrer authentischen Begegnung mit einer wahrhaftigen Wirklichkeit beschrieben werden kann, tut die Psychotherapie gut daran, ethische Fragen nicht als unwissenschaftliche Privatangelegenheit außer Acht zu lassen, wie sie es explizit zumindest gerne tut. Seelische Gesundheit und Ethik sind nicht voneinander zu trennen. Implizit ist es zudem so, dass kein Therapeut ohne - zumindest unbewussten - Bezug zur ethischen Ebene tatsächlich arbeiten kann, denn die Grundlage der Individualität ist bereits seine ethische Stellungnahme zum Ganzen. Um Manipulationen aus dem dialogischen Off zu vermeiden, ist es daher wichtig, sich ethischen Fragen als Person zu stellen und die eigene Ethik somit dem Klienten einsehbar stets neu infrage zu stellen.
Kinder kommen nicht neurotisch zur Welt. So hat es schon weiter oben geheißen. Anfangs, und wenn sie sich später nicht aus ihrer Mitte herausreißen lassen, betrachten und begreifen sie die Welt aus einer streng individuellen Perspektive. Dabei gibt es nichts, was vermuten ließe, dass sie vom eigentlich ethischen Prinzip der Treue zur Individualität abwichen und in wahrhaft konfrontierender Weise erscheint ihre ganze seelische Aktivität auf ihre persönliche Ansicht der Dinge zentriert. Im Verlauf einer idealen Entwicklung trifft der Egozentrismus des Kindes auf die Widerstände der Wirklichkeit und differenziert sich durch diese Begegnung mit der Realität aus, ohne dass dadurch die jeweils individuelle Perspektivität infrage gestellt werden müsste.
Tatsächlich kommt es jedoch meist zu zwei Kategorien äußerer Ereignisse, die dazu führen, dass das Kind seine Mitte verlässt. Zum einen geschehen Dinge, die das Wesen der kindlichen Psyche so massiv bedrohen, dass das Kind seine spontane Reaktion darauf nicht riskieren kann. Es wäre, oder wähnt sich, dadurch direkt vom Tode bedroht. Zur Rettung eines Teiles seiner perspektivischen Integrität verzichtet es dann auf deren Vollständigkeit und spaltet das Nicht-Integrierbare durch diverse Abwehrmanöver ab. Meist sieht es dann nur noch "auf einem Auge" oder beide Augen wechseln sich beim Sehen ab. Mit dem Auge, mit dem es jeweils sieht, sieht es den dann erkannten Teil allerdings oft messerscharf.
Zum anderen tritt die Außenwelt mit Erziehung, Verführung und Bestechung an das Kind heran. So verleitet sie es, die eigene Sicht zu verlassen und sich stattdessen fremde Ansichten ohne kritischen Abstand anzueignen. Dann lebt es mit fremden Sichtweisen, so als ob sie die eigenen wären. Es verstreut seinen ursprünglich gut fokussierten Standpunkt ins Umfeld. Statt den anderen von sich selbst aus gelassen ins Auge zu sehen, betrachtet es sich mit tausend fremden Augen, stets erfolglos darum bemüht, unvereinbare Bilder zur Deckung zu bringen. Da es den Fokus seiner Perspektive in das diffuse Bündel fremder Ansichten zerstreut, sieht es die Welt und sich selbst nur noch verschwommen. Resultat ist, dass es sich durch die Unklarheiten seiner Sinne zwar in allerlei Unerfreulichkeiten verwickelt, dass es aber zu unscharf sieht, um den Ansatzpunkt zu einer grundlegenden Verbesserung seines inadäquaten Verhaltens zu finden. Eigentlich tappt so ein Mensch dann stets im Dunkeln.
Beide Ereignisse, die Verleugnung des tatsächlich eigenen Standpunktes bedingt durch Drohungen und Verführungen des Umfeldes sowie das Wegblicken von dem, was man seelisch noch nicht ertragen kann, treten eine Kaskade psychopathologischer Symptomentwicklungen los. Diese Symptome bestehen solange, bis das Individuum zur eigentlich eigenen Ansicht der Dinge zurückkehrt. Erschwert wird diese Rückkehr dadurch, weil man nach Jahrzehnten der Verzerrung meist selbst nicht mehr weiß, wovon man einst weggeblickt hat. Kinder kommen ohne Kontaktstörung zur Welt. Ihre Psyche bleibt solange mit ihrem Lebensvollzug in einer syntonen Einheit verschmolzen, wie sie sich nicht auf Grund der beschriebenen Verzerrungen der eigenen Perspektivität vom unberührten Kontakt zur Umwelt zurückzieht. Der Rückzug von ursprünglich primären Kontakt wird notwendig, weil die individualitätswidrige Verzerrung des perspektivischen Weltbildes nur aufrechterhalten werden kann, soweit der korrigierende Kontakt unterbrochen bleibt. Denn der volle Kontakt ist die stimmige Ausrichtung der individuellen Perspektive auf den entsprechenden Ausschnitt der Wirklichkeit.